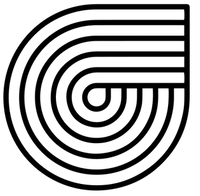Eckpunkte-Archiv 2022/23
Wirklich wahr?
3. August Der Gott aus der Maschine, „deus ex machina“: Das war einst ein Theaterkniff, inhaltlich, dramaturgisch, technisch. Aus der Schauspielkunst der Antike stammt er und betrifft redensartlich noch heute eine Situation, die uns irgendwann so heillos verfahren – oder, um mit den Worten „der Alten“ zu sprechen, einen „Knoten“, der uns so unauflöslich „geschürzt“ – vorkommt, dass Rettung nur noch durch das Eingreifen himmlischer Allmacht möglich erscheint. Den Gott ließen die Techniker der Antike, ihrerseits verborgen, in der Regel mittels eines Seilzugs in den Spielraum einfliegen. Nicht selten hatten sie dafür die Bühnen-„Maschinerie“ derart raffiniert hergerichtet, dass die Intervention aus dem Jenseits den Betrachtenden wie Zauberei erscheinen musste. In Bayreuths Festspielhaus auf dem Grünen Hügel ist Ähnliches zurzeit in seiner allermodernsten Form zu erleben. Wer dort zu den vergleichweise wenigen Zuschauenden gehört, denen während Richard Wagners „Parsifal“ eine AR-Brille zur Verfügung steht, der erlebt, zusätzlich zu den analogen Fiktionen auf der Bühne, tausend verwirrend bunte 3-D-Wimmelbilder aus der digital „erweiternden“ Computer-Zauberwelt der augmented reality. (Zur ausführlichen Besprechung der Produktion: hier lang.) Nun können wir skeptisch einwenden, dass unser Vorstellungsvermögen durch die Künste – zumal durch das Theater wie auch den Film und erst recht durch die Oper, das „unmögliche Kunstwerk“ (Oskar Bie) – längst schon hinlänglich aus unserer Wirklichkeit hinaus expandiert. Wozu also der entbehrliche Gimmick? Macht er die Kunst ‚wahrer‘? Vermutlich hat auch er, wie die menschheitsalte Lust am Fiktiven und Fingierten, dem Erfundenen und Erlogenen, mit unserem Spieltrieb zu tun. Schon die Marionetten und sonstigen Puppen des Figurentheaters erfüllen solchen Anspruch an völlige Andersartigkeit. Ebenso fasziniert der titelgebende Automat in Léo Delibes Ballett „Coppélia“, für das der französische Komponist 1870 seinen Stoff einer berühmten deutschen Novelle entnahm: In E.T.A. Hoffmanns „Sandmann“ verliebt sich ein überempfindsamer Jüngling in eine Schöne, die sich als Maschinenmädchen entpuppt, mit einem Räderwerk im Bauch, das mit einem Uhrschlüssel geräuschvoll aufgezogen wird. Frankensteins Monster, das gegenwärtig sein Unwesen auf der Luisenburg, Wunsiedels Naturbühne, treibt, ist letztlich auch nichts viel anderes. Konsequenter folgte vor vier Jahren die Regisseurin Dorothea Kirschbaum dem Beispiel Hoffmanns und Delibes’ mit einer Inszenierung von Guiseppe Verdis „Rigoletto“: Im Theater Krefeld schuf sie Gilda, die Tochter des traurigen Clowns, in einen Roboter um. Beim „Hi, Robot“-Festival 2019 in Düsseldorf ließen „Die Japanischen Philharmoniker“ und der für Konzept und Komposition verantwortliche Keiichiro Shibuya den Androiden „Alter 3“ singen: Die Mensch-Maschinen-Puppe war nicht nur mit einem elektrohydraulisch bewegten Metallskelett, Gesicht und Händen, sondern auch mit improvisationsfähiger „Künstlicher Intelligenz“ ausgestattet. Unlängst erhob ihr Nachfolger „Alter 4“ im Pariser Théâtre du Chatelet an drei Abenden die Stimme – leibhaftig begleitet von fünf fernöstlichen Mönchen und fünfzig Musikern. Mithin ist puristischen Theaterleuten Vorsicht empfohlen, andernfalls ersetzt demnächst vielleicht Technik vollends die darstellende Kunst und tote Mechanik uns echte Menschen. Dann wird, zumindest auf der Bühne, endgültig die Maschine zu Gott. ■
Schleichzeiten
21. Juli Bewunderung verdient er namentlich als Superhirn, staunen dürfen wir aber auch über die Portion Zurückhaltung, die Albert Einstein übte. An den großen Entdeckungen von Wissenschaft und Technik könne er sich „nur wenig freuen“, bekannte er, denn über das, was unsere Welt im Innersten zusammenhält, verrieten ihm alle Erkenntnisfortschritte das Entscheidende nicht: Er stellte sich darauf ein, dass er und Genies seinesgleichen bis zum „Verstehen des Fundaments“ noch eine Weile würden warten müssen. Und doch „verstand“ er weitaus mehr als irgendjemand vor ihm: In seinen hochkomplexen, doch auch unseren Normalgehirnen in immerhin ein paar Grundzügen verständlichen Relativitätstheorien definierte er den Raum und die Zeit physikalisch-mathematisch neu, indem er beider „fundamentales“ Verhältnis zueinander als Abhängigkeit entschlüsselte, in der das eine von beiden immer als Kehrseite des je anderen fungiert. Unlängst nun gelang es Geraint Lewis und Brendon Brewer, einem Australier und einem Neuseeländer, aufgrund eingehendster Himmelsbeobachtungen bis zu den Ursprüngen des Kosmos nachzuweisen, dass eine kurios anmutende Hypothese Einsteins der Wirklichkeit entspricht: Wie die Wissenschaftler bestätigten, lief die Zeit eine Milliarde Jahre nach dem Urknall – dem sich ja beides, Raum und Zeit, verdankt – fünf Mal langsamer als in unserer Wahrnehmung heute ab. Die Beweise hierfür würden die klugen Herren den meisten unter uns wohl kaum begreiflich machen können. Aber wir alle kennen aus eigenem häufigem Erleben, wie unterschiedlich schnell oder langsam ein Zeitabschnitt unserem subjektiven Empfinden vorkommen kann. Eine einzige Schrecksekunde durchleben wir wie in Zeitlupe, als ob wir alle Einzelheiten unter einem Mikroskop umständlich durchquerten. Umgekehrt bilden wir uns ein, dass eine dichte Reihe von Erlebnissen, freudigen zumal, die Zeit raffe, stauche, rasen lasse. Als „Zeitparadoxon“ kennen Psychologen dies Wechselspiel der Eindrücke. Zugleich schrumpft ein ‚leerer‘ Zeitraum – leer, weil wenig darin geschah – in unserer Erinnerung; umgekehrt freilich beansprucht in ihr eine Spanne der Geschehnisfülle umso mehr Platz. Als Stress quält uns die Hast; noch schlimmer aber kann uns das Warten peinigen, wenn wir bei der Durchsetzung unsere Absichten unfreiwillig eine Pause einlegen müssen. Dann liegt zwischen einem Pendelschwung der Uhr und dem folgenden scheinbar eine Ewigkeit. Solche Unterbrechung führt uns abermals zu einem Zeitparadoxon, einem der verzweifelten Art: Obwohl wirs kaum ertragen, dass die Zwangspause uns die Zeit stiehlt, tun wir doch, solang sie währt, alles, um uns die Zeit zu vertreiben. Dem Stress der Hetze suchen wir durch unsere begrenzte Fähigkeit zu effizientem Multitasking zu entgehen. Andererseits verlangt uns die Blockierung unseres Tatendrangs eine noch vornehmere Gabe ab: Geduld. In der „Powenzbande“, Ernst Penzoldts herrlich parodistischer Romansatire, bewährt sich der durchtriebene Patriarch Baltus Powenz mit seiner Devise „Alles verstehen heißt alles begreifen“ als Superhirn und Einstein seiner Sippe. Über viele Jahre hin hat er Backsteine gesammelt, nach und nach 999 Stück, und ausdauernd darauf gewartet, seiner Familie endlich daraus ein Haus zu bauen. So taugt er, wiewohl sonst zwielichtigen Charakters, zum Musterbild der Langmut. Langweilig wird ihm nie: ein Mann, der zu warten versteht. ■
Silber im Schatzsee
15. Juli Wenn ein Despot einem anderen nacheifernd auf die Spur zu kommen trachtet, wird schon mal die Landkarte verändert. 1928 ließ Benito Mussolini, der „Duce“ des italienischen Faschismus, den südöstlich von Rom gelegenen Nemisee leerlaufen, um an zwei einzigartige Wasserfahrzeuge zu gelangen, deren Besitzer seinen eigenen Cäsarenwahn noch überboten hatte. Der junge, irre Kaiser Gaius Caesar Augustus Germanicus, der in den Jahren 37 bis 41 unterm lachhaft verharmlosenden Namen Caligula, „Stiefelchen“, unheilvoll über den italienischen Stiefel und den Rest des Römischen Reichs regierte, hatte sie sich bauen lassen: zwei technisch ausgeklügelte, in Pracht und Ausmaßen überdimensionierte, mit Juwelen verzierte Ruderschiffe, beide über siebzig Meter lang und mehr als zwanzig Meter breit, mit einem Diana-Heiligtum, Obst- und Weingärten, Säulengalerien, Speisesälen, geheiztem Luxusbad. Ihre Überreste ließ Mussolini in achtzehn Metern Tiefe bergen und in einem eigens dafür errichteten Museum unterbringen, das am 1. Juni 1944 zwar ein Raub der Flammen wurde. Damit aber endete die Geschichte der Gefährte nicht. Denn von den Kostbarkeiten, die ihre Aufbauten und Rümpfe füllten, tauchen aus dem längst wieder gefluteten Gewässer Einzelstücke auf, so unlängst der Kopf einer Statue. Neben dem historischen Interesse reizen die märchenhaften Riesenbarken und jene ihrer Artefakte, die sich bis heute erhalten haben, auch die weitverbreitete Mythensucht. Die Landkarte der Legenden und Geheimnisse weist viele tiefe Wasser auf, in denen seit dem Untergang des sagenhaften Atlantis und seines vorpommerschen Pendants, der steinreichen Ostseestadt Vineta, Kostbarkeiten schlummern könnten. Wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollen Offiziere aus Adolf Hitlers „Wehrmacht“ im südbayerischen Walchensee tonnenweise Gold, Schweizer Franken und US-Dollars, sogar Edelsteine versenkt haben; Ähnliches wird ein wenig weiter westlich vom Alatsee, desgleichen vom Stolpesee in Nordbrandenburg erzählt – gefunden wurde, trotz verbissenen Forschens, nirgends etwas. Vergleichsweise lächerliche zwei Millionen Dollar könnte das Gold wert sein, das, wenn mans glaubt, 1865 im US-amerikanischen Lake Michigan versank. Stolze 180 Tonnen Gold hingegen birgt der Überlieferung zufolge der Baikalsee in Sibirien. Aber auch sie sind nichts gegen den vermeintlich größten Schatz im Meer, die 344 Tonnen Gold- und Silbermünzen, die 1708 mit einem spanischen Kriegsschiff vor Kolumbiens Küste untergingen. Wer sich für moderne Mythen, zugegeben in haarsträubender Variante, interessiert, sei in diesen Wochen auf das neue, fünfte Kino-Spektakel um den mittlerweile greisen „Indiana Jones“ und das unschätzbare, von ihm gefundene und entschlüsselte „Rad des Archimedes“ verwiesen (zur Filmkritik hier lang). Nicht zu zählen die vielen jungen Lesenden, die Karl May, der in seinen Fantasien unermüdlich abenteuernde Romancier, seit 1890 mitgenommen hat, um nach dem „Schatz im Silbersee“ zu suchen. Zwölf mal zwölf Wagen voller Gold soll Hagen von Tronje, weiland Gefolgsmann des Königs Gunther von Burgund, aus dessen Wormser Residenz fortgeschafft und irgendwo im Rhein versenkt haben. Wie es dazu kam, verrät ab übernächster Woche Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ bei den Festspielen in Bayreuth. Dann dürfen Opernfreunde sich neuerlich darin bestätigt fühlen, dass cäsarenhafter Reichtum selten glücklich macht und auch Gold ein Bodenschatz ist, der manchmal besser bliebe, wo er ist. ■
Geschundene Geschichte
11. Juli Der Mann, ein Brite, ließ erkennen, dass er von Geschichte keine Ahnung hat. Dennoch schrieb er sich mit seiner Tat in die Historie ein, im Wortsinn. Als Tourist in Rom machte er sich vor wenigen Wochen international bekannt, weil er ein Graffito auf eine Wand aufbrachte, nicht indes malend, wie sein ungleich kunstreicherer Landsmann Banksy es zu tun pflegt. Er grub seinen Namen und den seiner Freundin mit der Spitze eines Schlüssels in die Mauer – ausgerechnet in eine des Kolosseums. Natürlich gab es Zeugen, die den Übeltäter mit dem Handy filmten. Sogleich sauste die Videos durchs Internet, empörten die Italiener zwischen dem Norden Südtirols und Siziliens Süden und veranlassten die Polizei, den Unhold dingfest zu machten. Das Wahrzeichen der „ewigen Stadt“ – geschunden und geschändet! Dafür muss der 31-jährige nun eine schmerzhafte Geldstrafe gewärtigen: Womöglich werden ihm 20.000 Euro abverlangt, so viel wie dem Russen, der vor einigen Jahren am selben Ort das gleiche Delikt beging. Kein Wunder, dass der jetzige Delinquent sich Sorgen macht. Dieser Tage räumte er in Briefen an den Bürgermeister und die Staatsanwaltschaft den Vorfall „peinlich berührt“ und „bedauernd“ ein und entschuldigte sich mit einer Bildungslücke: Ihm sei, führte er allen Ernstes an, während der Schandtat nicht bewusst gewesen, „wie antik das Monument ist“. Dergleichen passiert schon mal. Soll ein Reisender denn über jede Sehenswürdigkeit Bescheid wissen, die am Wegrand oder Horizont beiläufig vor ihm auftaucht: Peterskirche, Eifelturm, Freiheitsstatue, Chinesische Mauer … ? Die Welt ist mit all dem Vielen viel zu voll, da kann niemand alles kennen. Gleichwohl bewies der junge Mann Geschichtsbewusstsein auf seine Art immerhin insofern, als er sich nicht durch plumpen Farbauftrag, sondern gleichsam reliefierend zu verewigen gedachte, hat doch der von ihm eingekratzte Schriftzug ebenfalls in Rom einen vielbeachteten Vorläufer: Die Kapitolinischen Museen bewahren eine auf dem Palatinhügel gefundene, in Stein geritzte Karikatur aus dem zweiten Jahrhundert auf, deren Urheber mit Text und Bild – einem gekreuzigten Menschen mit Eselskopf – die Passion Jesu, mithin die Christen und namentlich einen gewissen Alexamenos verspottete. Überhaupt stellte sich der Brite mit der Schürfwunde im Kolosseum in eine Tradition, die noch viel weiter zurück reicht, in vorzivilisatorische Zeiten, denn schon die Höhlenmenschen schmückten vor zigtausend Jahren ihre Behausungen mit eingegrabenen Mustern und Symbolen, mit Zeichnungen und Malereien aus. An Kunstfertigkeit freilich lassen viele der steinzeitlichen Hinterlassenschaften die Schlüsselkratzer weit hinter sich, mit denen der sorg- und kenntnislose Brite das etwa zweitausendjährige Amphitheater signierte. Wenigstens hat er nun jene „fifteen minutes of fame“ erlangt, die Viertelstunde Weltruhm, die Andy Warhol jedem Zeitgenossen zugestand. Und wahrlich, mehr als fünfzehn Minuten: Der britische Vandale und Italien werden ungleich länger daran denken. An die epochenübergreifende Bekanntheit, die „Wanderers Nachtlied“, Johann Wolfgang von Goethes berühmtestes Gedicht, geniest, reicht sein Schnitzwerk dennoch nie heran. „Über allen Gipfeln / Ist Ruh …“: ein Graffito auch dies, 1780 mit Bleistift an die Holzwand einer Hütte auf dem thüringischen Berg Kickelhahn gekritzelt. Mit dem Frevler aus England verbindet den Poeten lediglich, dass er damals gleichfalls 31 war. ■
Voll im Recht
6. Juli Zu den schlimmsten Vorstellungen altmodisch gesinnter Kulturmenschen zählt – neben Katastrophen wie Krieg oder Krankheit – jene, sie könnten das letzte lohnende Buch ausgelesen haben. Wie aber verfahren mit Druckwerken, die zur entgegengesetzten Kategorie gehören? Der Schreiber dieser Zeilen, der seine Bibliophilie vom Vater erbte und sie früh in dessen Bibliothek pflegte, erinnert sich, dass der alte Herr einst aus reiner Neugier sich die „120 Tage von Sodom“ des Marquis des Sade beschaffte, aber schon nach wenigen Seiten des anstößigen Romans entsetzt und abgestoßen davon abkam. Eine Zukunft wollte er dem Folterporno in seinem Haus keinesfalls gewähren, doch kam für ihn der übliche und kürzeste Weg der Entsorgung, via Abfalltonne, ebenso wenig infrage. Zum einen fürchtete er, die städtischen Müllwerker könnten bei der Leerung durch dummen Zufall das Buch zu Gesicht bekommen und völlig falsche Schlüsse ziehen. Zum andern, und nicht weniger bedeutsam, kam ihm ein sympathischer Mangel an Entschlusskraft in die Quere: Er brachte es schlicht nicht über sich, ein Buch, und wäre es das minderste, wegzuwerfen; seinem Sohn gehts übrigens genauso. Indes trat dieser Tage eine prominente Dame – mit achtzig Jahren älter, als der in Gewissensnöte geratene Vater damals war – mit einer radikalen Gegenposition an die Öffentlichkeit, eine Frau des Buches noch dazu: Donna Leon, weltberühmte Krimiautorin und als solche Erfinderin des venezianischen Kriminalisten Guido Brunetti, teilte in einem Interview mit, sie finde nichts dabei, ausgelesene Bücher wegzuschmeißen. „Aber ja“, entgegnet sie, offensichtlich mit dem Brustton der Überzeugung, auf eine dahingehende Frage, wobei sie immerhin einräumte, besser sei es, die ausgemusterten und -gemisteten Bände zu verschenken. Für ihre eindeutige, freilich auch nach Vandalismus klingende Haltung führte sie begründend an, dass Bücher „nicht heilig“ seien. Womit sie zweifelsfrei recht hat – sofern man das Wort heilig seinem eigentlichen Sinn gemäß versteht, also als Zuschreibung für etwas, das über alles Irdische erhaben, womöglich von Gottes Geist erfüllt ist wie die Bibel als „Heilige Schrift“ der Juden und Christen oder der muslimische Koran. Kann aber einer wie der Vater des Schreibers dieser Zeilen einem Roman wie dem des Herrn de Sade gerecht werden, wenn er zwar mit der Lektüre begonnen, sie aber abgebrochen hat? Auch hier weiß Frau Leon die Antwort: Ein in Angriff genommenes Buch müsse nicht zwingend ausgelesen werden, zum Beispiel sei sie selbst in Herman Melvilles „Moby Dick“ nicht ans Ende gelangt, „und ich habe auch nicht das Bedürfnis, ‚Moby Dick‘ zu Ende zu lesen“. Sie sollte es tun: ein wunderbares Buch. Aber natürlich muss sie nicht: So frei, wie die Gedanken eines Autors, einer Autorin sind, so frei dürfen Lesende damit verfahren. Gleichen Sinnes formulierte auch der französische Schriftsteller Daniel Pennac das dritte seiner „Zehn unantastbaren Rechte des Lesers“, deren allererstes lautet, dass jeder sich die Freiheit nehmen dürfe, überhaupt nicht zu lesen. Ein weiteres Grundrecht formulierte, lang vor Pennac, sein deutscher Kollege Kurt Tucholsky: das Recht, „sich seine Schriftsteller auszusuchen“. Seit jeher nimmt es der Schreiber dieser Zeilen strikt für sich in Anspruch. Freimütig gesteht er, zwar den dicken „Moby Dick“ zwei Mal, und immer mit Genuss, durchschmökert, nie aber auch nur eine Zeile von Donna Leon gelesen zu haben, und er hat, um die Autorin zu zitieren, auch künftig sehr wahrscheinlich „nicht das Bedürfnis“. ■
Jetzt gehts los
1. Julisub specie aeternitati In Friedrich Schillers Dramentrilogie um den warlord „Wallenstein“ seufzt der General Graf Terzky ungeduldig: „Mir ist alles lieb, geschieht nur was.“ Wie nebenbei sagt er uns damit, wie Geschichte ‚entsteht‘: dadurch, dass was geschieht. Das Historiker von sogenannten „großen Einzelnen“, Männern meist, erzählen, das war einmal. Um Ereignisse und Entwicklungen, Ursachen und Konsequenzen geht es ihnen nach wie vor. Von „politischen Konflikten und gesellschaftlichen Umbrüchen, aber auch vom Aufbruch in eine digitale Zukunft“ kündet seit zwei Wochen eine „große Erlebnisausstellung“ im Karlsruher Schloss; dort lädt das Badische Landesmuseum, eigenen Mitteilungen zufolge, zur „nostalgischen Zeitreise“ in „Die 80er“ ein, in „eines der aufregendsten Jahrzehnte der deutschen Nachkriegsgeschichte“. Derart fröhliche Vollmundigkeit reizt zum Gedankenspiel, ob denn ein Zeitabschnitt, der erst etwa vierzig Jahre zurückliegt, das Etikett „Geschichte“ schon verdient. „Punk und Party, Privatfernsehen und Gameboy, Waldsterben und Mauerfall“ führt das Museum als Alleinstellungsmerkmale des ins Auge gefassten Jahrzehnts an, und zumindest die beiden letztgenannten Sonderfälle haben das Zeug zum Epochenphänomen. Die drei ersten dagegen nicht? Doch, durchaus. Denn aus der jüngeren Kulturgeschichte unserer – sub specie aeternitatis, vom Blickpunkt der Ewigkeit aus, beobachtet noch nicht sehr alten – Bundesrepublik sind sie nicht wegzudenken und gehören, variiert und gesteigert, auch zur Gegenwart; zur „digitalen Zukunft“ sowieso. Der Umstand, dass die Karlsruher „Erlebnisausstellung“ von Dingen handelt, die viele von uns noch selbst erlebt haben, entzieht ihre Exponate nicht der Historizität. Vierzig Jahre sind immerhin mehr als ein Menschenalter, wie man früher sagte, und die Generation, die seither heranwuchs, hat mit den von ihr selbst erlebten oder verantworteten Begebenheiten politisch und gesellschaftlich, wirtschaftlich und kulturell Geschichte geschrieben. Wann aber ‚beginnt‘ Geschichte? Wann gings los? Im engeren Sinn mit der Erfindung und Entwicklung der Schrift, mit den Anfängen der Geschichtsschreibung. Allerdings sind deren Ideen, Intentionen, Wandlungen zugleich selbst Gegenstand der Geschichte, denn von Gesellschaften kann Vergangenheit nur wahrgenommen werden, indem sie – keineswegs objektiv – beurteilt und gedeutet wird. Mithin sind, was wir Geschichte nennen, nicht die Ereignisse und Entwicklungen an sich, sondern unser aktuelles Bild von ihnen. Dies wird sich ein „Menschenalter“ später gewandelt haben, und zugleich werden wir selbst Gegenstand historischer Beurteilung geworden sein. So betrachtet: Wann ‚beginnt‘ eine Epoche, Geschichte zu sein? Wie weit muss sie, mindestens, zurückliegen? Müßige Frage. Nicht an der Entfernung von uns und Heute bemisst sich die Historizität, die Geschichtlichkeit eines Geschehnisses, sondern an seiner Kraftentfaltung, am Ausschlag, den es auf dem Zeitstrahl markiert. Wenn der Fußballclub in Bad Doberan auf Facebook ausposaunt: „Unser Sommerfest ist Geschichte“, so übertreibt er liebenswert, doch maßlos. Unzweifelhaft hingegen, dass sich Corona und Ukrainekrieg, Klimakrise, ChatGPT in den Geschichtsbüchern künftiger Generationen geltend machen werden. Bereits die Zeitungs- und Nachrichten-Aufmacher von gestern sind Bruchstücke dokumentierter Vergangenheit, und Journalisten sind Chronisten der Geschichte im Augenblick ihrer Geburt. ■
Krone der Schöpfung
23. Juni 170 Millionen Jahre lang lebten Dinosaurier auf unserem Planeten, und es bedurfte einer kosmischen Katastrophe, um sie buchstäblich mit einem Schlag auszurotten: vor 66 Millionen Jahren mit dem Einschlag eines fünfzehn Kilometer großen Asteroiden auf der Halbinsel Yucatan. Gerade mal 300.000 Jahren treibt unsere Spezies homo sapiens sich auf Erden herum – und treibt es so schlimm, dass kein Steinschlag aus dem All nötig scheint, um uns oder unsere Nachfahren in ein, zwei Generationen über die letzte Grenze unserer Existenzmöglichkeiten hinaus zu bringen. Das besorgen wir schon selber – und erst seit gut einem Jahrhundert mit letzter Konsequenz. Im Roman „The Terranauts“ erzählt T. C. Boyle mit den Mitteln der Fiktion von einem vor etwa dreißig Jahren tatsächlich durchgeführten Experiment, durch das Forschende ermitteln wollten, ob wenigstens ein paar Überlebende der Menschheit in extraterrestrischen Kolonien die Chance nutzen können, eine neue, bessere Zivilisation jenseits der Heimaterde zu begründen – der Versuch ging übel aus (noch bis zum 16. Juli zeigt das Theater Hof im Studio eine spektakuläre Tanztheater-Version des Stoffs). Und mag auch der 74-jährige Starautor aus dem US-Bundesstaat Kalifornien, wo alljährlich ausgetrocknete Wälder großflächig niederbrennen, seinen jüngsten Roman „Blue Sky“ überschrieben haben, so macht er damit erst recht keine Hoffnung: Der titelgebende „Blaue Himmel“ kündet von Gluthitze, Wasserknappheit, Ernährungskrise, Artensterben. „Wir Menschen sind nur eine Spezies von vielen, warum sollte es nicht auch uns irgendwann erwischen?", fragte Boyle in der vorvergangenen Woche bei einer Lesung in Berlin. Wer meint, nicht der Mensch, sondern die Zelle, bestenfalls das Ei gehe als Krone der Schöpfung durch, der sieht sich seit Längerem durch Boyle bestätigt: Er nennt als Spitzenreiter die Mikroben. Irren mithin die Gläubigen, wenn sie sich und ihresgleichen den höchsten Rang einräumen? Immerhin lesen sie im achten Psalm des Alten Testaments, Gott habe den Menschen „wenig niedriger gemacht“ als sich selbst und ihn „mit Ehre und Schmuck gekrönt“. Folgerichtig erklärte die katholische Kirche in einer „Pastoralkonstitution“ aus dem Jahr 1965 unsereinen zur „einzigen Kreatur auf Erden, die Gott um ihrer selbst willen gewollt“ habe. Den Titel „Gaudium et spes“ trägt das vom Zweiten Vatikanischen Konzil erarbeitete Dokument – zu Deutsch: Freude und Hoffnung. Dass für beides indes nicht viel Anlass besteht, muss uns nicht erst T. C. Boyle verraten; das lernen wir täglich aus den Meldungen der offiziellen Klimabilanzierer, Waldschadensberichterstatter und Ökostrategen. Stehen wir tatsächlich im Rang der gekrönten Häupter unter den Geschöpfen, dann droht uns wie allen Tyrannen irgendwann brutaler Tod; im günstigsten Fall sind wir wie Könige in konstitutionellen Monarchien: verzichtbar. Die Natur braucht uns nicht; wir brauchen die Natur. Viel Gutes kann uns nicht auffallen bei der Suche nach adelnden Alleinstellungsmerkmalen: Zwar hat uns, dem englischen Anthropologen Richard Wrangham zufolge, unsere Zivilisation zu den „einzigen Tieren, die kochen“, gemacht. Weit besser aber stünde uns, umgeben von all dem Unheil, das wir anrichten, die Scham zu Gesicht, die Boyles vor 120 Jahren gestorbener Landsmann und Kollege Mark Twain ins Spiel brachte: ist doch der Mensch das „einzige Wesen, das errötet und Grund dazu hat“. ■
Homunculus der Lust
17. Juni Theater ohne Publikum lässt sich schwerlich denken. Selbst wenn keine Besucherinnen und Besucher die Sitze vor der Bühne füllen, guckt immer jemand hin: die Regisseurin, der Inspizient, die Beleuchter … Nicht zuletzt haben die Mitspielenden einander vor Augen. Will indes Theater all der Mühe wirklich wert sein, sind die Zuschauenden beinah so unverzichtbar wie das Ensemble selbst. In der „Rocky Horror Show“ sind sies sogar noch mehr als sonst, zumindest dann, wenn das Spektakel nach seinen eigenen, alle Konventionen sprengenden Regeln über die Bühne fetzen soll. Interaktives Theater muss es sein – wenn schon keines „zum Anfassen“ (wie man so sagt), so doch zum Mitmachen. Wer immer, ob Männlein, Weiblein oder in irgendeiner Art divers, das Live-Musi- und „Grusical“ besucht und auf sich hält, der trägt – wie die Hauptfigur Frank’n’Furter, die Transperson vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transsylvania – Mieder und Strapse, Netzstrümpfe und Pumps oder sonst ein der Show nachempfundenes Kostüm; obendrein führt er reichlich Reis und Toastbrot, Klopapier und weitere unter Fans einschlägig bekannte Zutaten bei sich, um damit aufs Stichwort um sich zu werfen. Am Freitag wurde Richard O’Briens bunte, laute, schlüpfrig bis drastisch aufgeladene Bühnenraserei fünfzig Jahre alt – am 16. Juni 1973 kam sie am Royal Court Theatre in London vor nur 85 Gästen heraus. Was Theaterleuten die Arbeit erleichtert, ist der Verzicht auf jeden deutbaren Hintergrund, auf tieferen Sinn unter der schrägen Oberfläche. Absurd, ironisch und für brave Bürger noch heute ein wenig provokant ist zu erleben, wie es ein Jungspießerpärchen nach einer Autopanne in ein gräuliches Schloss und dort in einen Kongress Außerirdischer verschlägt. Hier will Frank’n’Furter, sein Lebenswerk krönend, den Lustknaben Rocky Horror präsentieren. Wie weiland Faust, der bekennend heterosexuelle Gelehrte, den Homunculus, hat der schwule Alien das Wesen in der Retorte zusammengekocht. Vollends zum Welthit machte die Posse Jim Shermans US-amerikanische Verfilmung von 1975 mit Stars wie Susan Sarandon und Meat Loaf. Weil der Stoff, in welcher Gestalt auch immer, auf nichts reflektiert, konnte er in Theatern wie in Lichtspielhäusern zeitlos werden, zum Kult, der seit einem halben Jahrhundert den Namen verdient, jetzt, unter der Regenbogenflagge der LGBTQ+-Community, erst recht. Gespielt wird die verrückte Party weiterhin vielerorts, und längst bindet sich an die Teilnahme an ihr kein ausdrücklich antibürgerlicher Impetus, kein aufreizender Affront, keine freche Herausforderung konservativer Normalos mehr. An dem guten Geld, das Aufführungen nach wie vor abwerfen, verdienen auch schon mal Prominente mit, die sonst weder als Triebfedern der Bühnenkunst noch der queeren Szene namhaft wurden. So weisen die im April offengelegten Nebeneinkünfte des renommierten Linken-Politikers und langjährigen Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi für die laufende Legislaturperiode – insgesamt 236.300 Euro – nicht nur 180.000 Euro für gut sechzig Auftritte als Vortragsredner aus, sondern desgleichen 6000 Euro (brutto) für drei Aufführungen der „Rocky Horror Show“ im Berliner Admiralspalast, wo Gysi im März 2022 als Erzähler mitmischte. Die Morgenpost fand ihn „brillant“: Er habe sich „vom Publikum beschimpfen lassen“, aber „auch selbst ausgeteilt“ – ein „grandioser Sidekick“. So kennt man ihn aus dem Politikbetrieb und von Talkshows: Quer stellt der Mann sich gern, queer ist er nicht, vor Publikum aber durchaus ‚Kult‘. ■
Mit Überlänge
20. Mai An diesem besonderen Theaterabend gibt es 1 Virginia und 100 Martys auf der Bühne. Von den Herren samt und sonders gleichen Namens empfängt die Dame einen nach dem anderen, um immer wieder ein und dieselbe Szene durchzuspielen: den Moment, der besiegelt, dass die Beziehung des Paares alle Reste einstiger Romantik verloren hat und die beiden auseinandergehen werden. Seit Freitagnachmittag und noch bis heute, Samstag, 16 Uhr, präsentiert das Londoner Young Vic Theatre sowohl engelsgeduldigen wie eiligen Besucherinnen und Besuchern ein Stück, das für sich wahrlich Überlänge reklamieren darf, auch wenn „The second Woman“ – so der Titel – immer den gleichen kurzen Abschied verhandelt: Denn 24 pausenlose Stunden lang geht Ruth Wilson als Virginia Mal um Mal das Scheitern ihrer Liebe durch, wobei der Golden-Globe-Gewinnerin besagte Hundertschaft von hetero- und homosexuellen Männern, nicht binären und queeren Partnern gegenübertritt. Überwältigt pries die Zeitung The Guardian die „von der Idee bis zum Ergebnis atemberaubende kreative Leistung“ schon im Voraus. Wer sie begutachten will, kann dies während der kompletten 24-stündigen Vorstellung tun – oder sich, sobald er genug gesehen hat, wieder aus dem Auditorium davonmachen. Allerdings ist, was wie ein Guinness-Buch-verdächtiger Rekord aussieht, gar keiner. Als längste Aufführung eines regulären Bühnenensembles gilt seit neun Jahren ein Marathon des US-amerikanischen Lamb’s Player Theatre in der kleinen Stadt Coronado, Kalifornien: Dort hörte die Truppe erst zu spielen auf, nachdem sie während 76 Stunden, achtzehn Minuten und 25 Sekunden mehr als fünfzig Dramen- und Musical-Szenen abgearbeitet hatte; sogar hundert Stunden hätten die Damen und Herren gut durchgehalten, wäre zuvor nicht die Zahl der Zuschauenden den Vorgaben zuwider auf weniger als zwanzig gesunken. Bereits 1987 stand in London der Schauspieler Adrian Hilton auf der Bühne: Um beim Shakespeare-Festival ganz allein das Gesamtwerk des Bard of Avon vorzutragen, nahm er sich konditionsstark 110 Stunden und 46 Minuten Zeit – eine Bestmarke, die offenbar seither noch niemand geknackt hat. Doch selbst solche Ausnahmeresultate können einem wie Kurzdarbietungen vorkommen, wenn man sie am wirklich längsten Theaterstück der Welt misst. Das wird Jahr für Jahr im Herbst von Abertausenden vielfach bettelarmer, dennoch möglichst festlich gekleideter Inderinnen und Indern geradezu religiös gefeiert: „Ramlila“ lautet sein Titel, zwischen zehn Tagen und einem ganzen Monat, wie in der heiligen Hindu-Stadt Benares, kann es dauern. Erzählt wird darin (sehr verkürzt gesagt) von der Odyssee des makellos schönen und guten Gottkönigs Rama und seinem siegreichen Kampf gegen Ravana, den Herrscher der Dämonen. Ausschließlich Kinder spielen all das vor – und nur solche aus der höchsten Kaste der Brahmanen –, denn nur ihnen trauen die gläubigen Inder eine derart reine Unschuld zu, dass sie sich unterfangen dürfen, als Götter zu agieren. Auf ein bis zu 2300 Jahre altes Nationalepos geht der Stoff zurück, wurde aber erst von dem mystischen Dichter Tulsidas niedergeschrieben, dessen Todestag sich heuer zum 400. Mal jährt. Europas moderne Kulturmenschen halten schon große Stücke auf sich, wenn Sie Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ durchhalten: Läppische sechzehn Stunden dauern die vier Opern alles in allem; in Festspiel-Bayreuth werden sie schonungsvoll über sechs Tage verteilt. ■
Luftschlacht von 1665
9. Mai Schon lange bevor das Fliegen erfunden war, überlegten helle Köpfe, welche Art von Fahrzeug sich dafür eigne. Fahrzeug, nicht Flugzeug. Ganz so wie die alten Ägypter glaubten, ihr Sonnengott Re durchquere in einer Barke den Himmel, so ließ auch der phantasmagorisch veranlagte Dichter Jean Paul seinen „Luftschiffer“ Giannozzo durch die Lüfte segeln – in einer Montgolfiere, einem Ballon mithin, an dem nicht see-, sondern äthertauglich eine Gondel wie ein Nachen hing. „Luftschiff“ hieß noch der Zeppelin, dessen erster Start denn auch nicht als Jungfernflug, sondern als „Jungfernfahrt“ firmierte. Mittlerweile haben sich die Gestalten flugfähiger Vehikel stark verändert, was im Kosmos schon weit vorher der Fall gewesen zu sein scheint: Die ersten offiziell dokumentierten Ufos gingen vor 76 Jahren nicht als schwebende Zigarren, Tragflächenmaschinen oder Raketen in die Geschichte ein, sondern als „fliegende Untertassen“ – eine Benennung, der seither die Beschreibungen vieler weiterer angeblich beobachteter Alien-Raumschiffe als kreisrunde Scheiben formal folgen. Dabei rührt die Bezeichnung flying saucer von einem Missverständnis her: Nachdem am 24. Juni 1947 der US-Amerikaner Kenneth Arnold mit seinem Privatflugzeug über dem Bundesstaat Washington einer glitzernden Staffel von neun ihm unerklärlichen Objekten begegnet war, suchte er lediglich nach einem griffigen Vergleich; die Dinger, sagte er darum nach seiner Landung, seien ihm vorgekommen wie „Untertassen, die über eine Wasserfläche springen“. Nun kreisen im Weltall gewiss zahllose Planeten, die intelligentes Leben beherbergen – und sicher intelligenteres als auf der Erde –; andererseits lässt sich kaum ernsthaft denken, ultrahochentwickelte extraterrestrische Kulturen suchten unablässig ausgerechnet die Erde heim. Gleichwohl werden Wahrnehmungen, die Ufo-Sichtungen ähneln, bereits aus Zeiten berichtet, da die Menschen als Außerirdische bestenfalls die himmlischen Heerscharen der Engel anerkannten. Die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin zeigt in der Schau „Ufo 1665“ seit Freitag Druckblätter und Buchillustrationen, die das verstörende Erlebnis einiger norddeutscher Fischer aus dem Jahr 1665 zu einem der Medienhypes des siebzehnten Jahrhunderts aufbauschten: Die sechs Heringsfänger wollten von der Ostsee aus über Stralsund Vogelschwärme beobachtet haben, die sich in Kriegsschiffe verwandelt und dröhnend aus ihren Kanonen beschossen hätten. Sogar von einer flachen Scheibe „wie ein Teller“ sprachen sie: Die hätte sich über der Sankt-Nikolai-Kirche erhoben. Fünf Jahre später trafen Blitze deren Turm – gedeutet als „Donner-Ruten“ Gottes, galten doch derlei Himmelserscheinungen seit jeher als Vorzeichen kommenden Unglücks. Dementgegen fand Jean Paul zwischen Himmel und Erde drei Wege zum Glück offen: „Der erste, der in die Höhe geht, ist: so weit über das Gewölke des Lebens hinaus zu dringen, dass man die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinhäusern und Gewitterableitern von weitem unter seinen Füßen nur wie ein eingeschrumpftes Kindergärtchen liegen sieht. Der zweite ist: gerade herabzufallen ins Gärtchen und da sich einheimisch in eine Furche einzunisten. Der dritte endlich – den ich für den schwersten und klügsten halte – ist der, mit den beiden andern zu wechseln.“ ■
Kleinstschreibung
2. Mai Wie klein wir zu schreiben vermögen, führt uns der Bielefelder Schriftkünstler Gereon Inger eindrucksvoll vor: Auf einem lumpigen Kirschkern hat er alle 63 Wörter des Vaterunsers untergebracht, klar lesbar mit bewehrtem Auge. Zum Staunen regt das im Wortsinn minimalistische, mit Tusche und Lack gefertigte Artefakt an, zugleich zum Nachdenken darüber, dass typografische Großzügigkeit über die Größe eines Textes, womöglich seinen welthistorischen Belang nichts aussagt. Im kunstlos Alltäglichen indes, bei unseren Zettelwirtschaften oder Schriftwechseln, mag derartige Kleinstschreibung ein Defizit in unserem Sozialverhalten anzeigen: Schreiben wir so, dass es niemand lesen kann, signalisieren wir, dass wir im Grunde gar keinen Wert auf Gedanken- und Informationsaustausch legen. Eine Respektlosigkeit, der sich auch manche professionell Schreibende schuldig machen: So musste sich die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff Klagen ihrer Korrespondenzpartnerinnen und -partner darüber gefallen lassen, dass sie ihre Briefbögen von einem Rand zum andern mit mikroskopisch kleinen Buchstaben überfüllte. Im Nachlass fand sich, wie der Literaturwissenschaftler Thomas Wortmann schreibt, ein schmales „Konvolut von Manuskriptblättern, auf denen sich in ihrer mikrografisch anmutenden, nur schwer lesbaren Handschrift die Gedichte des zweiten Teils [ihres Zyklus] ‚Das geistliche Jahr‘ verzeichnet finden“, noch dazu „versehen mit zahlreichen Streichungen und Varianten, Ergänzungen, Korrekturen und Rückkorrekturen.“ Zu der radikalen Beschränkung, vermutet der Experte, hätten ihre Kurzsichtigkeit und ihr „Papiergeiz“ sie veranlasst. Für Herausgeber ein harter Brocken: ungefähr hundert Buchseiten moderner Druckart auf gerade mal sechs Bögen. Wie wir uns das vorzustellen haben, führt bis zum 30. September am Geburtsort der Poetin, der münsterländischen Wasserburg Hülshoff in Havixbeck, die Ausstellung „Droste Digital“ vor; an ihrer Gestaltung war unter anderen Nora Gomringer beteiligt, die aus Wurlitz bei Rehau stammende Lyrikerin und Leiterin des Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. Keine geringeren Hürden als Droste stellte Robert Walser den Editoren seiner Hinterlassenschaft auf. Zwischen 1924 und 1932, während einer seelischen Krise, hatte der Schweizer Schriftsteller ein „Bleistiftgebiet“ von über fünfhundert Blättern mit sogenannten Mikrogrammen bedeckt: dramatische Szenen, Lyrik- und Prosastücke auf kerzengeraden Zeilen in winzigstem Gekritzel. Bis weit nach seinem Tod im Schnee 1956 hielt man die Notate schlechthin für undechiffrierbar; dann gelang es drei geduldigen Forschern doch, sie zu transkribieren. Lesbar gemacht auf über zweitausend Buchseiten brachte der Suhrkamp-Verlag sie in sechs Bänden heraus. Auch Rückert und Tolstoi, Henryk Sienkiewicz (der polnische Autor von „Quo vadis“), Walter Benjamin oder Siegfried Lenz sollen sich oft oder immer solcherart Extrem-Minuskeln bedient haben. Zu denken ist ebenso an den Marquis de Sade, der, 1785 in der Pariser Bastille einsitzend, auf einer zwölf Meter langen Papierrolle „Die 120 Tage von Sodom“ verfasste, in aufs Engste gesetzten Zeilen. Über den historischen Belang des Hardcore-pornografischen Romans dürfen wir denken, wie wir wollen. De Sades zierliche Chiffren sehen jedenfalls aus wie die schmutzigen Hinterlassenschaften des die Zelle bevölkernden Ungeziefers. ■
Ich lebe noch
18. April Wer ein Mal in die hall of heroes Aufnahme fand, bleibt immer ein Held. Doch selbst Giganten zwingt das Alter irgendwann dazu, kleinere Brötchen zu backen. Vor wenigen Tagen teilten uns die Medien der Welt in Wort und Bild mit, wie tatkräftig Arnold Schwarzenegger Auto- und Fahrradfahrer in Los Angeles vor Schäden an Mensch und Material zu bewahren suchte: Öffentlichkeitswirksam legte er persönlich Hand an Schaufel und Teereimer, um ein mächtiges Schlagloch zu verfüllen. Auf dem Höhepunkt seiner Kinokarriere hat der Muskelprotz sowohl als übermenschlicher Zerstörer wie als Weltretter fast allmächtig agiert; als allwissend geht er heute, mit 75, im richtigen Leben nicht durch, hatte doch das Straßenbauamt die vom Filmstar missbilligte Grube aus gutem Grund für Wartungsarbeiten an der Gasversorgung ausgehoben. Mithin stellte sich „Arnies“ übereilte Guttat blamabel als Irrtum heraus – gerade dadurch aber kann sie die Ungewissheit erhellen, die wir jedes Mal auf uns nehmen, wenn wir uns mit etwas so schillernd Zwiespältigem wie einem Loch beschäftigen. Schon das Wort, wie jeder Terminus mit vielfältiger Bedeutung, steht stets in der Gefahr, falsch gebraucht zu werden. So ist ein Schlagloch keineswegs ein Loch, sondern bestenfalls Vertiefung, Senke, Mulde, denn allemal stößt es, als Abgrund im Kleinstformat, ziemlich bald auf Grund. Das Loch indes, geheimnisvoll bis zur Bodenlosigkeit und darum buchstäblich nicht zu fassen, ist an sich ein Nichts, wenn auch mit reichlich Etwas drumherum. Allein jenes Etwas (das selbst nicht Loch ist) macht es für uns im Alltag sicht- und begreifbar wie etwas Selbstverständliches, obwohl sich in ihm etwas manifestiert, das unserem Geist weit weniger zugänglich, weil unanschaulich ist: die Leere. Insofern ist es geschwisterlich der Lücke und dem Spalt verwandt, dem Nichts zwischen Etwas, das der Dichter Christian Morgenstern treffend als „Zwischenraum, hindurchzuschaun“, definierte. In der Welt des Zählens und Messens entspricht dem Loch (schon grafisch) die Null, die für sich genommen ebenso nichts bedeutet, aber eskalierend in Kraft tritt, sobald wir eine Ziffer vor sie setzen. Wie die Zwischenräume zwischen Zaunlatten weisen auch Löcher unterschiedliche Größen auf; sie können sich sogar ausweiten und verengen, wie es die Ozonlöcher über den Polen tun, die unsere Gesundheit gefährden. Andererseits tragen die Löcher im Käse bei maßvollem Genuss zu unserem Wohlbefinden bei und konnten es folglich zum Markenzeichen vor allem von Schweizer Sorten bringen. Wo wir den Blick von unserer Erde hinaus ins Offene, in das zwar von Abermilliarden Galaxien übersäte, gleichwohl weitestgehend leere Weltall lenken, stößt er unweigerlich auf die Schwarzen Löcher, die im Innersten der Sternsysteme rotieren und alles in ihrer Nähe, sogar das Licht, in sich hineinziehen, ohne je wieder irgendetwas freizugeben. Rätselhaft spiegelt solche Radikalität die Ursprünge unseres modernen Worts „Loch“, das sich zugleich aus uralten Ausdrücken für Öffnung wie für Verschluss herleitet. Wer darin einen Widerspruch vermutet, irrt wie Arnold Schwarzenegger, wofür Redensarten ein plausibles Beispiel geben: Mag uns die Polizei auch ins Loch sperren – stellt sich unsere Unschuld heraus, verlassen wir die Zelle durch das Loch, das der Zimmermann gelassen hat. Mit derlei Paradoxien gehen Kinder erfahrungsgemäß sehr lässig um: Weil die Mutter des Schreibers dieser Zeilen den Semmelkloß in einer Gugelhupf-Form zu garen pflegte, konnte der älteste der Söhne regelmäßig fordern, mit dem Loch als Extra-Leckerei bedacht zu werden. ■
Verborgene Verbindungen
5. April Wie in so vielem steckt auch in dem Umstand, dass wir uns unsere Verwandten im Allgemeinen und unsere Geschwister im Speziellen nicht aussuchen können, so viel Glück wie Unheil. Die einen freuen sich, weil sie ohne die Mühe, erst umständlich Gefährtinnen und Kameraden finden zu müssen, von früh auf jemanden zum Spielen und zum Unsinn-Machen, zum Einander-Ärgern und als Alliierte gegen die Erwachsenen an ihrer Seite wussten. Andere leiden lebenslang darunter, dass sie es, als der oder die Älteste, unter den Geschwistern am schwersten hatten oder, weil am jüngsten, zu wenig beachtet oder, weil irgendwo in der Mitte in die Welt gekommen, von allen Seiten gepiesackt wurden. Gerade am „Tag der Geschwister“ - der, aus den Vereinigten Staaten kommend, bei Bedarf am kommenden Montag begangen werden kann - mag auffallen, dass Söhne oder Töchter derselben Erzeuger ein jeweils ganz eigener Menschenschlag sind und dass unser Verhältnis zu den einstigen Nestnachbarn auffallend beeindruckenden Veränderungen unterliegt. Natürlich wandten sich Mythen und Künste dem Thema gierig zu, nicht erst mit den berühmten „Drei Schwestern“, die Anton Tschechow 1901 in Moskau auf die Bühne brachte. Weit früher schon, 1782, hat Johann Carl August Musäus ein Märchen „Die drei Schwestern“ veröffentlicht, das sogar vorübergehend in die „Kinder und Hausmärchen“ der Brüder Grimm Aufnahme fand. Während Brüder oft einfach nur Geschwister sind, scheint es bei Schwestern vorzukommen, dass, wie zumindest Sagen und Poeten behaupten, etwas Immaterielles sie aneinanderknüpft, über Blutsverwandtschaft und häusliche Gemeinschaft hinaus. Die Griechen der Antike stellten neun schwesterliche Musen dem Hüter der Künste, Apollon, zur Seite. Von sieben Plejaden, jungfräulichen Nymphen, glaubten sie die Göttin Artemis begleitet. In über fünfhundert Liedern besingen die Aborigines Australiens die sieben oder drei oder zwei Schwestern ihrer Weltursprungssagas. Aus drei späten Mädchen, hinreißenden Autorinnen mit melancholischen Naturellen, formierte sich zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts eine staunenswerte Schwestern-Trias der britischen Literatur: In einem stillen Winkel Englands, im Pfarrhaus von Haworth in der graubraunen Tristesse der Moore von West Yorkshire, reiften die Brontë-Sisters zu erstrangigen Erzählerinnen heran. Seither werden ihre klassischen Romane in vielen Ländern gelesen und immer mal wieder verfilmt. Anne Brontë, die jüngste, ersann die Geschichte der „Agnes Grey“; Emily, die mittlere und prominenteste, die wuchtigen „Wuthering Heights“ (Sturmhöhe); Charlotte, die Älteste, die fiktive Autobiografie der „Jane Eyre“. In den Romanen finden duldsame Heldinnen auf Um- und Fluchtwegen durch Gefahren und Geheimnisse gemütsbewegend zu den Männern ihres Herzens. Mehr als solche Melodramatik fasziniert an den Stoffen der Ladys die Weite ihres Geistes, die Tiefe der Empfindung, womit sie der einförmigen Enge ihrer Lebenswelt Hohn sprachen. Schwestern: Nach den Plejaden heißt bis heute eine Sternenformation am Firmament. Und „Drei Schwestern“ ist auch der Name eines 2053 Meter hohen Berges an der Grenze zwischen Österreich und Liechtenstein. Von seinem Hauptgipfel aus eröffnen sich, wenn man Wanderführern glauben darf, traumhafte Blicke ins Rheintal und zum Bodensee. Statt des steilen Hauptwegs bietet sich, anders als bei der Durchquerung eines hürdenreichen Familienlebens, „für Ungeübte“ auch eine „leichtere Variante“ an. ■
Ich lebe noch!
1. April Er ist überall, nur kennt ihn keiner. Streng basisdemokratisch verfährt Gevatter Tod, weil er niemanden vergisst: Nichts ist so tödlich wie das Leben, wie unvorhersehbar lange es auch währt. Immer gleich bleibt sich der Tod, nur die Elemente wechseln, denen wir Überlebende die Dahingeschiedenen anvertrauen. Lange legten unsere Vorfahren sie hierzulande bevorzugt in die Erde, damit sich die „sterblichen Überreste“ in ihre organischen Grundstoffe auflösen. Heute übergeben wir sie zumeist dem Feuer; die Asche verstreuen manche vom Flugzeug oder Schiff aus in die Luft, den Ozean, als übergäben sie die Überbleibsel der Ewigkeit. Keiner kennt den Tod – aber manch einer oder eine von uns sieht ihn kommen; und weil wir ihm nur ein Mal selbst, zuvor ausschließlich an anderen begegnen, sitzen wir dabei unter Umständen Verwechslungen auf. Der Scheintod, jener bewusst- und bewegungslose Zustand, in dem der Leib nicht mehr zu atmen und nichts zu spüren, das Blut in ihm nicht mehr zu pulsen scheint, er kann uns Angehörige leicht in Todesschrecken versetzen – und selbst Ärzte gründlich täuschen. Besonders Letzteres beunruhigt nicht wenige: Was, wenn unser Koma so trügerisch und anhaltend ausfällt, dass man uns guten Glaubens ins Grab senkt oder in den Ofen des Krematoriums schiebt? Zurzeit zeigt das Theater Hof ein Musical über einen prominenten Dichter, den jene Vorstellung tagtäglich marterte: Von Hans Christian Andersen, Dänemarks großem Märchenerzähler, wird glaubhaft überliefert, er habe schon lang vor seinem Tod 1875 Abend für Abend einen Zettel neben seinem Bett angebracht mit der Versicherung: „Ich lebe noch!“ Taphephobie nennen Psychotherapeuten jene krankhafte Angst. Wie begründet ist sie? Andersens US-Kollege Edgar Allan Poe, der sich in mehreren Erzählungen dem grauenhaften Thema widmete, behauptete in seiner Novelle „Lebendig begraben“ von 1844, er wisse von mindestens hundert wahren Fällen. Jener „grässlichsten der Qualen“ widmete der Schweizer Gottfried Keller vierzehn Gedichte („Ha! was ist das? die Sehnen zucken wieder, / Wie Frühlingsbronn quillt neu erweckt das Blut!“). Um solch einsamer Pein zu entgehen, verließen sich Betuchte auf „Sicherheitssärge“ mit Luftzufuhr und überirdischem Alarmglöckchen oder einer Signalfahne. Unbegründet war die Sorge tatsächlich nicht: verlief doch in langen Epochen, und namentlich während Seuchenzügen, die Leichenschau eher obenhin – schon weil meist Priester sie vornahmen, die über wenig Sachkenntnis verfügten, sich aber umso mehr selbst vor Ansteckung fürchteten. So wollte, später, denn auch Arthur Schopenhauer, als Philosoph notorisch pessimistisch, so wenig wie dem Leben dem Tod vertrauen und verlangte, post mortem so lange unbestattet zu bleiben, bis sich an ihm untrügliche Zeichen der Verwesung zeigten. Ähnlich verlässlich trachtete Alfred Nobel davonzukommen: In seinem Testament verfügte der Erfinder und Preisstifter, ihn nach dem letzten Atemzug aus den geöffneten Pulsadern ausbluten zu lassen, damit es auch wirklich der letzte Atemzug gewesen sei. Mit einem Sonderfall haben es gläubige Christen gerade jetzt, in der Passionszeit, zu tun: Ihrem Glauben nach wurde Jesus, als „Menschensohn“, zwar tot ins Grab gelegt – an Ostern aber feiern die Gemeinden die Auferstehung des Messias. Weder die Frommen noch die Atheisten unter uns sollte die Unvorhersehbarkeit des letzten Stündleins verängstigen; ganz im Gegenteil dürfen wir sie zu schätzen wissen als den Umstand, der uns beruhigt am Leben hält. ■
Dicke Brocken
18. März Gern wär er ein harter Hund gewesen. Ein schwerer Brocken war er immerhin. Seine Fettleibigkeit verdankte Max Reger einem notorisch immensen Fleisch- und Alkoholkonsum. Doppelt suchtkrank war der Komponist - zumindest insofern also mag die Aktion für fragwürdig gelten, mit der am Montag Weiden in sein „Jubiläumsjahr“ startete: Dort wurde, beim „Pre-Opening“, ein „etwas stärkeres, eigens kreiertes Festbier“ verkostet, das „mit Sicherheit ganz im Sinne Regers gewesen“ wäre, wie Oberbürgermeister Jens Meyer versicherte. Der „etwas stärker“ gebaute Tonsetzer, der vor 150 Jahren, am 19. März 1873, im oberpfälzischen Brand, nicht weit von Marktredwitz und Tirschenreuth, zur Welt kam, hatte sein exzessiv ins Monumentale strebende Leben nach nur 43 Jahren aufgebraucht, saufend, schlemmend – pausenlos schaffend. Als selbst ernannter „Akkordarbeiter“ hinterließ er ein Riesenœvre, das 23 CDs mit Kammer-, sechzehn mit Orgel-, zwölf mit Klaviermusik umfasst, dazu Orchesterwerke für mindestens ein Dutzend weiterer Platten, gut und gern 250 Lieder, Chorstücke … Hauptsache, reichlich, immer und von allem. Aber ein harter Hund war Reger nicht. Schwankend zwischen Euphorie und Erschöpfung, witterte er mimosenhaft überall Intrigen. Unstet durchzog er die Lande auf fortwährenden Reisen, zunehmend gefeiert, gar mit einem Festival geehrt. Und doch hetzte ihn sein „bipolarer“ Geist von einem manischen Geniegipfel zum nächsten Krater der Depression. Auf den vielen Porträtfotos formen nicht die Augen, sondern die wulstig-fleischigen Lippen das Hauptmerkmal seiner Physiognomie – der mehr herausfordernde als ausdrucksvolle Mund eines Genussmenschen. Und doch: der Mund eines Ausdruckskünstlers. Musik diente Reger als Medium seines hitzigen oder empfindsamen, jedenfalls stets erregten Bedürfnisses nach Expression. Ratio und Pathos, kalkulierende Vernunft und unmittelbare Gefühlsansprache des Hörers verbanden sich darin. Als Weidener Schüler hatte er fünfzehnjährig eine Bayreuther Festspielaufführung von Richard Wagners „Parsifal“ erlebt: sein Erweckungserlebnis. Die „großen B“, Beethoven, Brahms und, allen voran, Bach wählte er sich zu erzheiligen Idolen. Der Übermenschlichkeit der eigenen Lebensleistung war er sich bewusst und begriff sie als „radikal fortschrittlich“. Indes fühlte er sich von den Neutönern unter seinen Kollegen als Zuspätgekommener gering geachtet. Dabei imitierte er die verehrten Vorbilder der Vergangenheit nicht, sondern verwandelte sich ihre Errungenschaften in Demut an. Was die kontrapunktisch ausgefeilte – auch schon mal ermüdend unübersichtliche – Komponier- und Fugentechnik seiner Tonsprache anbelangte, konnte ihm kein Konkurrent so leicht das Wasser reichen. Bewusst als schwere, dicke Brocken sind viele Werke konzipiert: vieles, was für die Orgel entstand, das Violin-, das Klavierkonzert, der oratorische „100. Psalm“. Weit vertraulicher spricht sein Eigenidiom sich etwa in der orchestralen „Romantischen Suite“ oder den „Vier Tondichtungen nach Bildern von Arnold Böcklin“ aus. Den Einsiedler“, ein kurzes Stück Vokalsymphonik für Bariton, Chor und Orchester (oder Klavier) nach Joseph von Eichendorffs traumhaft-traurigen Versen, hat er knapp ein Jahr vor seinem Tod, im Weltkriegsjahr 1915, als eine seiner letzten Partituren vollendet – in jeder Hinsicht vollendet: Zum „Schönsten, was ich je geschrieben“, zählte er selber das Bekenntnisstück, zu Recht. „Komm, Trost der Welt, du stille Nacht, / der Tag hat mich so müd gemacht“: aus der Feder eines erst 42-Jährigen ein Requiem in eigener Sache. ■
Netz im Netz
8. März Wo die kollektive Erinnerung unserer Vorfahren an ihre Grenzen stieß, dort, wo ihre historische Schau nicht mehr weiter zurück reichte, da kamen die Mythen ins Spiel. Den Menschen kündeten sie plausibel von ersten und letzten Dingen, von Göttinnen und Göttern, Heldinnen und Heroen, die mit übermenschlichen Zielen, Gaben und Kräften den Kosmos schufen, die Natur formten, durch die Zeiten wirkten bis in eine äußerste Zukunft hinein, in der alles sein äußerstes Ende finden würde. Die Erdenwesen in ihren Beschränkungen durften sich und ihr oft genug nichtiges Kleinklein in den Großtaten der Gewaltigen wiedererkennen, weil auch die, ungeachtet ihrer Monumentalität und Transzendenz, blind akuten Leidenschaften folgten, sich in Hingabe und Hass verzehrten, liebten und logen, den Rausch und die Ranküne liebten, sich in Parteien entzweiten und, wo sie ihre Ehre beleidigt meinten, einander grausam bekämpften. Nicht, dass jemand Bestimmtes sich berufen gefühlt hätte, wie ein Autor solche Geschichten, gültig für alle seinesgleichen, zu ersinnen und in die Mit- und Nachwelt zu setzen; aus mählich sich entfaltenden Kulten, aus anonymen Ideenkernen und über Generationen sich fortzeugenden und wandelnden Motiven entstanden die Mythen, von denen etliche ein Thema angeben, das die mancherlei Kulturen der Menschheit seither in vielgestaltigen Variationen vielschichtig durchspielten und noch -spielen. Mythen reflektieren fernes Geschehen und persönliche Erfahrung im Riesenformat; was nicht hindert, sie gleichsam unters Mikroskop zu legen, um den wildwüchsig verästelten Verbindungen zwischen ihren Protagonisten und Nebendarstellern nachzuspüren. „Ob Sisyphos-Arbeit, Sirenen-Ruf, Achilles-Ferse oder Hermes-Bote –“, unterstreicht die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Mythen des antiken Europa „sind heute allgegenwärtig als Metaphern, Markennamen oder etwa als Inspiration für Literatur und bildende Kunst.“ Höchst zeitgemäß zeigt sich dies im „interaktiven“ Online-Portal www.mythoskop.de, das die Multimediadesignerin Anke Tornow zusammen mit Experten der Hochschule bewundernswert detailliert erarbeitet hat. Das Netz der Mythen „im Netz“, im world wide web: Den verwirrenden, indes nur scheinbar chaotischen Kosmos der alten Narrative erschafft das (frei zugängliche) Portal im digitalen Welt-Raum aufs Raffinierteste neu. Wer sich ein wenig Zeit nimmt, mit der dynamischen, über mehrere gekoppelte Informations-Sphären und -Schichten ausgedehnten Website vertraut zu werden, dem erschließt sich der schier unerschöpfliche Fundus der Götter- und Heldentaten aus dem Mittelmeerraum inhaltlich, chronologisch, kartografisch, rezeptionsgeschichtlich bis in die frühesten Quellen der schriftlichen Überlieferung hinein und bis in die jüngste Zeit. Und auch ohne allzu starkes Interesse an jahrtausendealten Titanen und Kyklopen, Harpyen, Nereiden oder Hekatoncheiren darf man staunen angesichts eines digitalen Experiments, das über die konkret bezweckte Sisyphos-Arbeit, den Mythen-Katalog, weit hinausweist. Denn indem es komplex und spektakulär gelang, vereint es in einem für ganz unterschiedliche Einblicke tauglichen Medium die übernatürlichen Gestalten der Fiktion und die irdischen Manifestationen messbarer Wirklichkeit, das ganz große Kino überdimensionaler Sagenstoffe und ihre banalen Reflexe im Alltag unserer anthropologischen Konstanten, die zu Geist sublimierte, nach Ewigkeit strebende Menschheitserzählung und die anschauliche, zudem ästhetische Grafik auf der Höhe der Zeit. ■
Keinesfalls lesen!
2. März So ‚heilig‘ kann kein Buch sein, dass sich nicht Menschen irgendwie daran vergriffen. Unseren mittelalterlichen Vorfahren, sofern sie überhaupt lesen konnten, war sogar die Lektüre der Bibel untersagt, zumindest sollten all jene Christenmenschen, die nicht dem geistlichen Stand angehörten, sich ja nicht unterstehen, selber volkssprachliche Übersetzungen der Heiligen Schrift zur Hand zu nehmen und sich womöglich ein eigenes Bild von der Heilsgeschichte zu machen. Deren Verbreitung und Auslegung behielt der Klerus sich jahrhundertelang als Herrenwissen vor. Zu den besonders widerwärtigen Auswüchsen des historischen Antisemitismus gehört der päpstliche Befehl Gregors IX. aus dem Jahr 1239, in Frankreich, England und Spanien alle Exemplare des Talmuds zu beschlagnahmen, in dem das Judentum seine Gesetze und religiösen Überlieferungen sammelt. Zwar zeigte sich nur der – noch arg jugendliche und von Geistlichen entsprechend beeinflussbare – französische König Ludwig IX. zum Gehorsam geneigt, dies aber konsequent: 1242 wurden in Paris auf 24 Wagen Tausende Handschriften des Talmuds und anderer jüdischer Texte zusammengekarrt und auf Scheiterhaufen verbrannt. Muss uns da nicht vergleichsweise harmlos anmuten, was heute in Russland, was in der Ukraine geschieht? Vor wenigen Tagen meldete der Deutschlandfunk, Bibliotheken in Moskau beugten sich einer obrigkeitlichen Anordnung, Bücher westlicher Autorinnen und Autoren aus dem Verleih zu nehmen; so verschwänden nun beispielsweise die Romane von Stephen King und die „Harry Potter“-Abenteuer Joanne K. Rowlings aus den Regalen. Zwar bestreitet die Regierung dergleichen; Mitarbeiter der Einrichtungen indes bestätigen die Meldung. Auf der anderen Seite haben ukrainische Bibliotheken bis Ende November (neuere Zahlen liegen nicht vor) neunzehn Millionen Bände in russischer Sprache ins Altpapier entsorgt, und keineswegs nur solche, die im Zusammenhang mit Putins barbarischem „heiligem“ Angriffskrieg auf das Land verdächtig erscheinen; vielmehr sollen auch die Werke von unbezweifelbar weltliterarischen Klassikern wie Alexander Puschkin und Fjodor Dostojewski darunter sein. Trifft das alles zu, so sollten uns die grausigen Ausmerzungen ebenso profund erschrecken wie die „Liste verbotener Bücher“, die zwischen 1559 und 1966 der Vatikan auflegte: Jener Index librorum prohibitorum der katholischen Kirche ächtete so Verschiedenartiges wie Galileo Galileis kopernikanisch-neuzeitliche Kosmologie, die bestialischen „120 Tage von Sodom“ des Marquis de Sade oder den als gotteslästerlich und sittenlos gebrandmarkten „Ulysses“ von James Joyce, aber auch Harriet Beecher Stowes frühes Black lives matter-Epos „Onkel Toms Hütte“. Tiefer kann nur sinken, wer, wie es manche Familienväter im antiken Rom mit ihren Sklaven taten, den Menschen das Lesen – und Schreiben – überhaupt verbietet. In modernen Kommunikationsgesellschaften eine Unmöglichkeit, für liberale Demokratien, in denen Meinungs-, Presse-, Publikationsfreiheit zu den obligaten Stützen des Staates zählen, ein unvorstellbarer Zustand. Freilich leben auch in solchen Ländern Menschen unter uns, denen das Lesen gleichsam verboten ist; allein hierzulande sollen es kaum glaubliche 6,2 Millionen oder 12,1 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung sein. Wir nennen sie Analphabeten, und sie haben unser aller Anteilnahme und Engagement verdient. ■
Wer Ohren hat
17. Februar Grabesruhe gibts auf unserer Welt nur im übertragenen Sinn, Totenstille kommt allein im Weltall vor, weil sich dort, in Ermangelung jeglicher Atmosphäre, buchstäblich kein Lüftchen regt, das Schallwellen transportieren könnte. Unseren Planeten verschmutzen wir, so wie mit einer Übermenge künstlichen Lichts, auch mit dem Getöse und Geräusch, das wir fortwährend produzieren, ob ohrenbetäubend wie beim Start eines Flugzeugs, ob im verhaltenen Plauderton wie beim Friseur. Immerhin dort soll nun wenigstens vereinzelt auch Ruhe einkehren: Von London aus, wo Coiffeure dergleichen schon seit Längerem anbieten, hat der silent cut nun auch Berlin erreicht – der stumme Haarschnitt ohne Meinungsaustausch, Tuschelei und Flüsterpropaganda. So kann der Salon, den die Redseligen unter uns seit je als sozialen Treffpunkt schätzen, von Fall zu Fall zu einer neuen Art von stillem Örtchen werden. Dem Bedürfnis nach Ruhe, das viele von uns drängt, kommt dies diskret entgegen. Aber hätten wir vor einem Jahr für möglich gehalten, dass ausgerechnet ein kosmetischer Akt der Körperpflege uns mit den behaarten Köpfen auf die ewige Dialektik von Lärm und Lautlosigkeit stößt? Und bedenken wir, wenn wir uns silently waschenschneidenlegen lassen, dass wir die Stille gar nicht selten fürchten? Im Walde, der bekanntlich „schweigt“, ficht Unheimlichkeit uns an, wandernd im Nebel, der allen Hall und Schall wie durch Watte dämpft und schluckt, peinigt uns der Eindruck, gottverlassen im Nichts ausgesetzt zu sein, und selbst in Haus und Wohnung, wenn wir uns dort allein befinden, schreckt uns gelegentlich der horror vacui, bis wir Radio oder Fernseher anschalten, damit jemand zu uns – wenn schon nicht mit uns – spricht. Einerseits ängstigt uns die Stille vor dem Sturm, weil sie mit baldigen Gefahren oder Mühen droht. Andererseits ziehen mehr und mehr von uns sich in die Meditation zurück (wofür zum Beispiel Marc de Smedts Buch „Lob der Stille“ Anreiz bietet), während andere, fast zum selben Zweck, die bewegungslose Schweigsamkeit beim Angeln vorziehen (inspiriert von Karl. H. Prätzlers Geschichtenband unterm selben Titel). Gerade jetzt, in den letzten Tagen von Karneval und Fasching, stößt uns nach jeder Büttenreden-Pointe das „Tä-täää, tä-täää, tä-täää“ der Blaskapellen-Tuschs unliebsam ans Gehirn – da wäre uns womöglich John Cages kühne, 1952 veröffentlichte Komposition „4‘33‘‘“ („Four Minutes and thirty-three Seconds“) lieber: Dem chronografischen Titel gemäß besteht sie gut viereinhalb Minuten lang aus nichts als Stille, in drei Sätze unterteilt, jeder mit tacet überschrieben – er/sie/es schweigt. Sowohl für Sologeiger oder-pianisten eignet sich das Werk als auch für Festivalorchester, die es noch eindrucksvoller interpretieren: Dann offenbart sich das Schweigen erst eigentlich als Harmonie. „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“, rät schon die Bibel. Indes umdudeln in Boutiquen, Hotel-Lounges und Lifts nutzlose Weisen unsre Trommelfelle, als wollten sie die reife Einsicht Wilhelm Buschs bestätigen, Musik werde „oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden“. Darum gehört zur Tonkunst – nicht anders als der Klang – die Pause, hier nur einen Wimpernschlag, dort mehrere Sekunden lang. In Theaterhäusern gibts die Pause auch, jedoch pflegt sie dort ausgesprochen hörbar zu verlaufen. Da loben wir uns Ödön von Horvaths Volksstück „Kasimir und Karoline“, das zurzeit in Hof auf dem Spielplan steht: Die häufigste Regieanweisung darin lautet „Stille“. ■
Das kann warten
4. Februar Unsere Redensarten und Alltagsphrasen verdanken wir keineswegs nur der Überlieferung von alters her. Auch von jüngeren Buch-, Film- und Songtiteln kommt das eine oder andere Versatzstück auf uns, mit dem wir unsere Konversation floskelhaft ergänzen. Wenn wir, zum Beispiel, etwas suchen und nicht finden, halten wir es für „Vom Winde verweht“; was uns durch Wiederholung langweilt, kommt uns „08/15“ vor; wenn Fußballtrainer einen Sieg ihrer Mannschaft ersehnen, hoffen sie nicht einfach, sondern geben sich dem „Prinzip Hoffnung“ hin; wenn wir bei einer schlechten Angewohnheit ertappt werden, lächeln wir schüchtern: „Oops! I did it again“ ... Unter theateraffinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen mischen sich auch schon mal Wendungen aus der Bühnenkunst in die Sprechroutine ein; so, wenn uns jemand fragt: „Worauf wartest Du?“ Dann entgegnen wir lässig: „Auf Godot.“ Nur darf niemand weiter fragen und wissen wollen, was oder wer das sei, dieser Herr – oder diese Frau? – Godot: Nach Gott (englisch god) klingt das Wort, und ähnlich unerklärlich und unsichtbar wie jener bleibt das Rätselwesen des Stücks, dem Samuel Beckett diesen Namen aufgeprägt hat: „Warten auf Godot“. Das ist godooh auszusprechen, denn der Autor schrieb die Urfassung auf Französisch nieder. In Frankreich auch erlebten die zwei einander ähnlichen Akte ihre Uraufführung, vor siebzig Jahren: Am 5. Januar 1953, im aufs Absurde eingestellten Théâtre de Babylone in Paris, warteten die gelangweilt-lustigen Landstreicher Estragon und Wladimir zum ersten Mal überhaupt, erstmals deutsch sprechend standen sie sich acht Monate später im Berliner Schlosspark-Theater die Beine in den Bauch. Erst zwei Jahre später durften sie in London in der englischen Muttersprache ihres irischen Erfinders parlieren. Immer warten sie vergebens, denn Godot erscheint nicht. Ein Knabe teilt ihnen mit, „morgen“ werde er gewiss eintreffen. Immerhin stoßen später noch ein gewisser Pozzo und Lucky, sein Faktotum, dazu. Aber auch sie tragen dem Geschehen nicht das bei, was die Dramentheorie als Handlung, Konflikt, Bedeutung benennt – was also, vor Alfred Jarry und Beckett, Eugène Ionesco und ihresgleichen, den Sinn der Bühnenaktion stiftete. Sinn sollte ihr radikales Theater explizit nicht haben; allenfalls besteht sein Sinn darin, zu zeigen, dass der Lauf der Welt ganz sinnlos sei. Erst recht fehlt jedes transzendente Ziel. Wollte auch Beckett selbst nicht mehr über seine Figuren gewusst haben „als das, was sie sagen und tun und was ihnen widerfährt“, so wusste er eines doch ganz sicher: Godot ist nicht Gott. „Ich weiß auch nicht, ob er existiert. Und ich weiß nicht, ob die beiden, die auf ihn warten, an ihn glauben oder nicht.“ Ist es denkbar, dass die Ausgangssituation des Stücks bereits 1844 im „Struwwelpeter“ des deutschen Arztes und (schwarzpädagogischen) Kinderbuchautors Heinrich Hoffmann eine grausige Entsprechung fand? „‚Konrad!‘ sprach die Frau Mama, / ‚ich geh aus, und du bleibst da.‘“ Auf Mamas Rückkehr wartend, mithin existenziell verlassen, tut der arme Junge, was man am strengsten ihm verbot: Er lutscht am Daumen; worauf aus dem Nichts zwar weder Gott noch Godot einfliegt, wohl aber („Bauz!“) ein dämonischer Schneider „mit der Scher“, um („klipp klapp“) die nassgesaugten Finger zu kupieren. In unserem Umgangssprachschatz erhielt sich, abgewandelt, auch jene literarische Steilvorlage: „Ach komm, geh zu, bleib da!“ ■
Drei in einem
31. Januar Wer sich von uns nur ein wenig mit Philosophie beschäftigt, der weiß, dass nicht das Festhalten an unumstößlichen Systemen, sondern der Zweifel an ihrer Unumstößlichkeit unser Denken weiterbringt. Jahrtausendelang freilich konnte jedes Misstrauen gegen fürstliches oder klerikales Herrenwissen schlimme Folgen haben. Erlitten hätte sie beinahe Martin Luther, der 1521 beim Reichstag zu Worms den Flammentod als Ketzer hat gewärtigen müssen. 79 Jahre später bestieg ein italienischer Schwerintellektueller in Rom dann wirklich den Scheiterhaufen: Giordano Bruno, dessen Geburtstag sich heuer zum 475. Mal jährt, hatte sich erfrecht, nicht allein die Gestalt Jesu Christi als fleischgewordene Personifikation Gottes zu beargwöhnen, obendrein stellte er die „heilige Dreifaltigkeit“ Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist infrage. In unseren säkularen Zeiten weigert sich eine zunehmende Zahl von Zeitgenossinnen und -genossen, sowohl das eine wie das andere für bare Münze zu nehmen. Aus unserem Sprachgebrauch hat sich die anschauliche Vorstellung gleichwohl nicht fortgestohlen: jene bildkräftige Allegorie, die eine umso abstraktere Trias für untrennbar gehaltener Elemente unauflöslich umfasst. Acht Tage bevor Wladimir Putin seinen Angriffskrieg vom Zaun brach, zitierte das Warschauer Onlineportal Nexta ihn mit Worten, in denen er pathetisch eine „dreieinige“ Nation beschwor, bestehend aus Russland, dem durchaus willigen Belarus und der gänzlich abgeneigten Ukraine. Ähnlich profan reimte, zum Beispiel, vor Jahresfrist Peter Lenfers, Pfarrer im westfälischen Warendorf, in einer Karnevalspredigt: Am Wochenende vor Rosenmontag scheute er sich nicht, Long-Covid, „Long-[Faschings-]Prinz“ und „Long-[Schützen-]König“ zu einer irdischen „Dreieinigkeit“ zusammenzuführen. Tusch: sehr witzig. Immerhin führen die Pointe und ihr kirchlicher Urheber auf den vor allem geistlichen Bezug des Begriffs zurück; wie es auch die Zeitung Die Rheinpfalz tat, als sie sich in der Mythenwelt rund ums rheinland-pfälzische Mutterstadt umsah: Bei einer „Dreieinigkeit aus Weißer Frau, Gespenstermönch und Höllenhund“ wurde sie fündig, wohlgemerkt „an einem Ort, an dem laut Sage ein inzwischen untergegangenes Kloster gestanden haben soll“. In Einrichtungen solcher Art halten die frommen Brüder und Schwestern natürlich eisern am Glauben an die von Giordano Bruno geleugnete Trinität fest. Und seit jeher taufen die Kirchen des ausdrücklich monotheistischen Christentums Kinder „auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“, wie es der auferstandene Jesus im Matthäus-Evangelium anordnet. Also was ist dieser Gott denn nun: Ist er drei? Oder doch nur einer? (Und unbedingt männlich?) Wenn wir so fragen, helfen uns aufgeschlossene Theologen gern mit vergleichenden Hinweisen auf das Wasser weiter: Das tritt ja auch in dreierlei Gestalt auf, als Dunst, als Flüssigkeit, als Eis. Warm darf es uns bei Jean Paul werden: Zwar, als frostigen Albtraum ließ der Dichter schon mal eine „Rede des toten Christus“ vom Stapel, „dass kein Gott sei“, geträumt aber wird die Horrorvision - ein „Blumenstück“ aus dem „Siebenkäs“-Roman - „an einem Sommerabende vor der Sonne auf einem Berge“; im „Titan“ entwirft er, gleichfalls bei sommerlicher Temperatur, eine vollends freundliche Szene: Da kutschiert „unter dem schönsten Himmel“ ein „offener Triumphwagen“ herum, besetzt mit Damen, einer „weiblichen Dreifaltigkeit.“ ■
Ich will mich
17. Januar Nicht, dass jemand diese Begriffe durcheinanderbringt! Monogamie bedeutet: Jemand ist nicht mit mehreren Geschlechtspartnern verheiratet, sondern hat ganz brav an einem oder einer einzigen genug. In der Sologamie hingegen findet solche paarbildende Genügsamkeit erst eigentlich ihre Vollendung: Dabei verwandelt sich das in Standesamt und Kirche gehauchte „Ja, ich will“ in ein selbstbezügliches „Ich will mich“; denn der oder die Verliebte heiratet niemand anderen, sondern sich – die Einehe als Selbstehe. Dergleichen kommt tatsächlich vor und geschah, zum Beispiel, vor etwa einem halben Jahr mal wieder mitten im US-amerikanischen Showbiz (wenngleich deutschsprachige Medien erst seit wenigen Tagen darüber berichten): Ende November verriet die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez dem Rolling Stone-Magazin, sie habe sich bereits im Juli zuvor, anlässlich ihres dreißigsten Geburtstags, eine „Hochzeit geschenkt“, die sie mit Freundinnen und Freunden glanzvoll als „Feier der Selbstliebe und des Selbstvertrauens“ zelebrierte. In der Party gipfelte offenbar eine Attacke von Torschlusspanik. Eingedenk der 350 Millionen Fans, die dem noch jungen Superstar auf Instagram folgen, scheint dies zunächst wenig glaubhaft; doch machte Gomez geltend, sie sei in der Überzeugung aufgewachsen, spätestens „mit 25 verheiratet zu sein", um sich fünf Jahre nach dem Stichtag nun so zu fühlen, als wäre sie von ihrem Ziel so weit entfernt wie nie. „Das hat mich umgehauen: Ich dachte, meine Welt sei vorbei.“ Ist also nach der opulenten Festlichkeit mit mehrstöckiger Torte, rotem Rosenmeer, Tanz und dem Auftritt einer Stripperinnen-Truppe alles gut? Schon 2017 berichtete der Spiegel über eine „kleine, aber wachsende Bewegung von Menschen, die sich selbst heiraten“ – meist Frauen in den Dreißigern –, und nannte als seinerzeit „letztes prominentes Beispiel“ das brasilianische Victoria’s Secret-Model Adriana Lima. Der Neuen Zürcher Zeitung war das - zwischen Selbstfürsorge und eitler Eigenliebe unbestimmbar changierende - Phänomen kürzlich einige analysierende Überlegungen wert. Eine Wurzel ermittelte sie in der populären Fernsehserie „Sex and the City“, in der schon vor zwanzig Jahren die von Sarah Jessica Parker gespielte Carrie Bradshaw ankündigte, sich mit sich selbst zu vermählen. Viele Sologamistinnen, schlussfolgerte das Blatt, sähen ihren sehr speziellen Lebensentwurf „als Auflehnung gegen das patriarchale System, in dem Hausarbeit und Kindererziehung noch immer nicht fair zwischen den Geschlechtern aufgeteilt“ seien. Andere Quellen führen weitere Gründe an: Etliche von denen, die sich derart rückhalt- und bedingungslos zu sich selbst bekennen, wollen sichtbar signalisieren, dass keiner ihr Leben als Single für ein leeres Loser-Dasein halten solle; andere haben wohl zu viele Enttäuschungen erlebt, um noch irgendjemand anderem zu vertrauen. Vielleicht gehören auch die genannten Damen dazu: 2009 hatte Adriana Lima den Basketballer Marko Jarić geheiratet, von dem sie sich 2016 scheiden ließ, und Selina Gomez war, unter anderem, mit Justin Bieber liiert, sogar zwei Mal. Haben sie und ihresgleichen schlicht die Nase voll? Wer ihrem Beispiel nachfolgen will, sollte zwar bedenken, dass Stande- und Kirchenämter die Selbstehe weder anerkennen noch beurkunden. Das bedeutet aber zugleich, dass solcher Bund fürs Leben sich auch nach dem autoerotischen Vollzug notfalls wieder annullieren lässt. ■
Wege zum Himmel
10. Januar Das Artefakt sieht sportlich aus: wie ein Diskus im XXL-Format. 32 Zentimeter misst es im Durchmesser, 32 Sterne in bewusster Ordnung sind darauf zu sehen, darunter (augenscheinlich) die sieben Plejaden, ferner ein Horizont, ein voller und ein sichelförmiger Mond sowie die Sonne, geradezu symbolisch in Gestalt einer Barke. Auseinander gehen die Ansichten über das Alter des Objekts: Mindestens 3600 Jahre? Oder weniger als 2600, wie vor drei Jahren zwei Forscher behaupteten? Einigkeit aber herrscht darin, dass es „echt“ ist – also gehörig alt –, ja sogar als die „weltweit älteste bekannte Darstellung einer konkreten Himmelssituation“ gelten darf. Und die Experten wundern sich, dass derart exakte Beobachtungen im frühgeschichtlichen Mitteleuropa sowohl gemacht als auch festgehalten wurden. Als „Himmelsscheibe von Nebra“ genießt das aus Bronze geschmiedete, mit dünnen Goldauflagen verbrämte Wunderding weltweit Interesse und Bewunderung und firmiert seit 2013 als Weltdokumentenerbe. Am 4. Juli 1999 hatten Raubgräber es auf dem Mittelberg im Burgenlandkreis aus dem Boden geholt – zusammen mit je zwei Schwertern, Beilen und Spiralen (als Armschmuck) sowie einem Meißel – und es an Hehler vertickt. Die flogen 2002 in Basel auf, als sie die Scheibe weiterverkaufen wollten. Binnen Kurzem klassifizierten Wissenschaftler den Fund als Sensation. Freilich lässt sich seine kulturhistorische und ideelle Kostbarkeit mit Zahlen nicht ermessen; selbst ihr horrender Versicherungswert von hundert Millionen Euro sagt wenig darüber. Kein Wunder, dass in der „Arche Nebra“, dem futuristischen Besucherzentrum nahe beim Fundort, eine Kopie zu sehen ist; das wohlverwahrte, 2,2 Kilogramm schwere, bis zu 4,5 Millimeter dicke Original präsentiert indes das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Beide, „Arche“ und Museum, sind Stationen der „Himmelswege“, die das sachsen-anhaltische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie den prähistorisch interessierten Reisenden geebnet hat (und die, außer nach Nebra und Halle, auch nach Langeneichstädt, Goseck und Pömmelte führen). Wer bei Winter-, Wind und Regenwetter gegenwärtig lieber zu Hause bleibt, kann und sollte im Internet das hochinstruktive, noch dazu sehr schicke „E-Museum Himmelswege“ virtuell durchstreifen. Die staunenden Besucherinnen und Besucher unterrichtet es mittels fasslicher Texte und erhellender Grafiken über Guss und Gestaltung der ursprünglichen Scheibe höchstwahrscheinlich 1600 Jahre vor Christus – am Ende der frühen Bronzezeit –, über die nicht weniger als vier Phasen der Umgestaltung in den zweihundert folgenden Jahren, mittels eines faszinierenden 3-D-Modells auch über die Fundsituation mitsamt den Beifunden. Vermutlich half das flache Schmiedestück – halb Visiereinrichtung, halb Rechenschablone –, die Tage der Sonnwenden festzustellen und vielleicht auch zwischen Sonnen- und Mondjahr zu vermitteln. Weil für die Menschen jener Epoche der Himmel immer auch Götterhimmel war, wobei sie keine trennende Linie zogen zwischen Naturkunde und Metaphysik, war das Objekt gewiss auch Kultobjekt. Seit seiner Befreiung aus dem Grab ist es wieder eins: Kaum ein anderes vorgeschichtliches Fundstück nördlich der Alpen hat die Zeitgenossen derart fasziniert. Lange meinte der Mensch, die Erde sei eine Scheibe; seit der Exhumierung von Nebra weiß er: Der Himmel ist eine. ■
Stunde null, Jahr eins
24. Dezember Die Null darf uns absurd vorkommen, denn sie ist ein seltsames, für unseren Normalverstand ungreifbares, unbegreifbares Ding. In der Null kommt zusammen, was nicht zusammengehört, nämlich Nichts und Etwas, mehr noch: Nichts und Alles. Sie ist eine Zahl, doch nichts, weiß unser Menschenverstand, lässt sich zählen mit ihr, es sei denn, es treten andere Zahlen hinzu, die größer sind als sie, was kein Kunststück ist. Null, der ungefüllte Kreis, bezeichnet eine Menge, die nur Leere enthält, wenn wir aber, sozusagen ‚links‘ von ihr, etwa eine Eins hinzusetzt, haben wir mit einem Mal nicht nur ein Ding, sondern zehn Dinge; und je mehr solche nichtigen Kringel wir ‚rechts‘ dazukritzeln, desto weiter entfernen wir uns in Richtung Unendlichkeit. Deren Symbol ist die liegende Acht, mithin so etwas wie zwei an ihrem Rand sich berührende Nullen – das begreife, wer will. Gleichwohl fand die Null, obwohl ein Ding jenseits der Existenz, bildkräftig in die Alltagssprache: Unter uns Menschen ist eine Null jemand, der durchaus leibhaftig vor uns steht, nur dass wir ihm vorwerfen, ein Versager, ein Nichts zu sein. Die „Null-Bock-Generation“ der Achtzigerjahre hatte zwar Lust auf nichts, trat aber in zigmillionen Menschenexemplaren auf. Und wer uns auf ein Anliegen mit mit als den Wörtern „Null Problemo“ antwortet, will glauben machen, zu allem in der Lage zu sein. Weil die Null nichts ist, kann sie – scheinbar – auch kein Anfang sein, weswegen auf Uhren, die den Namen verdienen (weil sie nämlich noch große und kleine Zeiger haben), die Zwölf den Nullpunkt jeder Stunde markiert. Die „Stunde Null“ wiederum, der 8. Mai 1945, an dem die Nazis das von ihnen in den Weltkrieg geführte Land zertrümmert zurückließen, hatte wirklich mit so etwas wie dem Nichts zu tun: Niemand konnte ahnen, wie und mit wem und ob es überhaupt weitergehen werde. Indes ist nicht die Null allein, auch die Zeit ein ungreifbares, unbegreifliches Ding, etwa indem sich, anders als die Stunde, das Jahr der Null verweigert: Denn mit dem Jahr eins hebt unsere Zeitrechnung an, was wir, wenn wir kurz nachrechnen, für ganz logisch halten müssen. Im - längst nicht mehr sehr christlichen - Abendland bleiben wir dabei, die historische Zählung mit jenem Jahr beginnen zu lassen, in dem Jesus von Nazareth das Licht einer den Messias ersehnenden Welt erblickt haben soll; wann immer das tatsächlich stattfand: Die plausibelste Theorie terminiert den Moment irgendwann zwischen den Jahren 7 und 4 „vor Christi Geburt“. Letztere setzte sich allerdings erst ein gutes Halbjahrtausend „nach Christi Geburt“ als Ausgangspunkt der Historiografie durch: Mit der Festlegung beendete der gelehrte Mönch Dionysius Exiguus im Jahr 525 einen Streit unter Gelehrten. Den nächsten Schritt müssen wir dann nicht mehr für logisch halten: Sofern Jesus, wie überliefert, am 25. Dezember ins Leben trat – warum feiern wir dann Neujahr am 1. Januar? Weil unsere säkulare Welt an dieser Setzung, einem Erbstück der ‚heidnischen‘ Antike, bis heute festhält. Nach Janus heißt der erste Monat in unserem Kalender, nach jenem zweigesichtigen transzendenten Wesen aus der römischen Mythologie, das zugleich vorwärts und rückwärts schaut, als ob es alles im Blick hätte, sich aber für nichts entscheiden könnte. Dem Gott oblag unter anderem die Sorge für Türen und Tore, für Durchgänge also, Null-Stellen des Raumes, die sowohl in etwas hinein- als auch wieder herausführen, weil zu allem Anfang auch stets ein Ende gehört. ■
Zwei Kilo Kopfputz
10. Dezember Die Träger wechseln, die Krone bleibt. Aber selbst mit dem royalen Kopfschmuck verhält es sich nicht anders als mit unseren normalen Alltagshüten (sofern wir welche tragen): Nicht jede passt jedem. Die Edwardskrone, 1661 geschaffene Hauptpreziose der britischen Kronjuwelen, bedeckte zum letzten Mal einen königlichen Scheitel, als am 2. Juni 1953 die damals 27-jährige Queen Elizabeth II. vier Monate nach dem Tod ihres Vaters George VI. in Westminster Abbey damit gekrönt wurde. Danach kehrte sie wieder in den Hochsicherheitstrakt im Londoner Tower zurück – denn nur zu jenem singulären Anlass trägt sie eine Königin, ein König. Wahrscheinlich durchaus zur Zufriedenheit der frischinthronisierten Monarchen: wiegt doch das dreißig Zentimeter hohe Machtsymbol, aus sehr viel Gold und einigem Silber, zudem fast 450 erlesenen Edelsteinen und Perlen gefertigt, 2,23 Kilogramm – schwer genug, um bei längerem Balancieren auf dem Kopf für einen steifen Nacken zu sorgen. Darum steht für dienstliche Obliegenheiten ein leichteres Modell zur Verfügung, die Imperial State Crown, die sich mit etwa einem Kilo bescheidet, wengleich sie den geschätzten Wert der Edwardskrone – etwa vierzig Millionen Dollar – um ein Mehrfaches übertrifft. Nun sehen wir dem 6. Mai entgegen und damit der Krönung des vormals ewigen Kronprinzenen Charles zum dritten britischen Königs seines Namens, wofür die Kopfzierde am vergangenen Sonntag nach über siebzig Jahren zum ersten Mal wieder aus ihrer Schatzkammer herausgeholt wurde. Denn sie muss an die einschlägigen Körpermaße des neuen Trägers angepasst werden: Der Kopfumfang des frischgebackenen Regenten übertrifft den der Mama, und eine zu kleine Krone sieht auf einem erlauchten Haupt wohl ebenso lächerlich aus wie ein zu kleiner Hut auf einem unserer Durchschnittsköpfe. Dies alles bedenkend, mögen wir kaum fassen, dass das Wort Krone sehr schlicht vom lateinischen corona für Kranz herrührt. Wohl auf den Lorbeerkranz als antikes Ehrenzeichen etwa für Potentaten, Militärs oder Sportler gingen im europäischen Mittelalter sowohl die Idee als auch die Form der Krone zurück: auf einen um die Stirn zu tragenden Goldreif und allerdings außerdem auf den Königshelm germanischer Stammesanführer. Heutzutage passt der Begriff auf alles Mögliche, das in buchstäblichem oder übertragenem Sinn herausragt: Krone nennt der Mediziner den sichtbaren Teil des Zahnes über dem Zahnfleisch (oder die metallene, keramische oder kunststoffliche Rekonstruktion), in Tschechien und Skandinavien heißen Währungen so, der Jäger spricht auf diese Weise vom Geweih eines Rehbocks, der Uhrmacher vom Rädchen, mit dem an alten Armband- und Taschenuhren das Werk aufzuziehen und die Zeit einzustellen ist, die Botaniker bezeichnen mit Krone die Blätter einer Pflanzenblüte, erst recht den von Ästen und Gezweig gebildeten Teil des Baumes oberhalb des Stammes. Positive Bedeutungen allesamt; indes verkehren sie sich durch Ironie auch gern ins Gegenteil: Schwer Betrunkenen werfen wir vor, einen in der Krone zu haben, und einen Meister der Unverschämtheit bezichtigen wir, er setze allem die Krone auf. Der durch den Zustand unserer Welt weidlich widerlegte Standpunkt, wir Menschen dürften als Krone der Schöpfung gelten, wird selbst durch die Vornehmheit königlicher, zeremoniös gekrönter Häupter nicht glaubhafter. Es fiele uns kein Zacken aus der Krone, lernten wir wenigstens, endlich das zuzugeben. ■
Doppelter Schwindel
3. Dezember Im US-Buchhandel kostet das Buch mindestens 29,70 Dollar. Es sei denn, der Autor hat es persönlich signiert, dann erhöht sich der Preis auf knapp das Siebzehnfache: Für die gebundene Originalausgabe von Bob Dylans am 1. November erschienene „Philosophy of modern Song“ werden, sofern der Singer-Songwriter und Literaturnobelpreisträger seinen Namen eintrug, stolze 599 Dollar fällig. Macht für die eigenhändige Unterschrift 569,30 Dollar. Auf neunhundert Exemplare beschränkte der Verlag Simon & Schuster die Sonderauflage – echte Sammlerstücke sollten unters Volk kommen und als Raritäten ihr Geld wert sein. Sind sie aber nicht: alles Fake. Autor und Verlag sahen sich in der peinlichen Lage, einräumen zu müssen, dass Dylan wohl kein einziges der Exemplare je in Händen hatte, geschweige denn mit seinem Namenszug veredelte und adelte, wenngleich ein Echtheitszertifikat dies zu bestätigen vorgab. Die Unterschrift leistete statt seiner eine Autopen genannte Signiermaschine, was im Literatur- und Kunstbetrieb gang und gäbe zu sein scheint. Den düpierten Fans – auch wenn sie mit Rückerstattung der Wuchersumme rechnen dürfen – drängt sich nun die Frage auf, wie sich ein Star, dem es an Ruhm so wenig wie an Reichtum fehlt, auf derlei Machenschaften einlassen konnte. Dylan, 81-jährig, entschuldigte sich mit Symptomen von Altersschwäche: Wegen wiederholter Schwindelanfälle habe er keinen pen, Stift, selbst führen können. Nun erhöhen handschriftliche Eintragungen keineswegs immer die Kostbarkeit von Büchern, im Gegenteil. Wer erinnerte sich nicht an eine Schulgrammatik oder ein Algebra- oder Geschichtsbuch, durch zügellose Schmierer- und Kritzeleien unlesbar und wertlos geworden? Auch wer besitzerstolz seinen eigenen Namen auf dem Vorsatzblatt eines Bandes hinterlässt, macht ihn noch nicht zu etwas Besonderem. Bücher, an selber Stelle mit einer lieben Botschaft des oder der Schenkenden versehen, steigen immerhin in ihrem sentimentalen Wert. Wer indes den Roman oder Lyrikband einer literarischen Zelebrität mit persönlicher Widmung und authentischer Unterschrift sein Eigen nennt, darf sich freuen: In solchen Fällen kann der Geldwert den Kaufpreis vielfach übertreffen. Damit hatten auch die Käufer der dylanschen Song-Philosophie gerechnet – und fielen einem doppelten Schwindel zum Opfer: Dem Künstler will die Täuschung taumelnd unterlaufen sein, mit der Störung des Gleichgewichtssinns ging eine Störung seines Rechtsempfindens einher. Aus einer spendablen Laune heraus leistete sich der Schreiber dieser Zeilen vor zwölf Jahren den Luxus, „Wagners Hund Russ“ aus der Werkstatt Ottmar Hörls zu erwerben, als lebensgroße schwarze Kunststoff-Vollplastik für 350 Euro. Mit eigenhändiger Signatur des Konzeptkünstlers hätte sie gut 700 Euro gekostet. Pro Buchstabe 87,50 Euro? So weit reichte die gute Laune dann doch nicht, die sich allerdings angesichts des Wertzuwachses hebt: Heute lägen die Preise bei 500 und 900 Euro, teilt Hörls Website mit, die übrigens auch klarstellt, die Skulptur könne „wegen ihrer Abmessungen nur als Sperrgut versendet werden“. Beim Postversand von Dylans Buch erübrigt sich solcher Warnhinweis: Es passt in ein normales Päckchen. Auch um ein Exemplar mit der gefälschten Signatur enttäuscht und zornig zu entsorgen, sind keine Umstände nötig: Zum Sperrmüll taugt es so wenig wie zu einem Original. ■
Zwanzig Volltreffer
26. November Da mache jemand etwas, „das man nicht machen darf“: So umriss 2012 in Tübingen der Kurator Daniel Schreiber den künstlerischen Ansatz des Pop-Art-Künstlers Allen Jones. In der dortigen Kunsthalle dokumentierte vor zehn Jahren die bis dahin größte Retrospektive seines Lebenswerks die schamlose Lust und unverschämte Wucht, mit denen der damals 74-jährige Brite althergebrachte Tabus zu brechen liebte. Aufs Provokanteste tat ers etwa durch die 1969 gefertigten, seither so berühmten wie berüchtigten Möbelstücke, die er aus Skulpturen kaum bekleideter, devoter Fetischladys geschaffen hatte. Im Jahr zuvor war Jones in Kassel auf der vierten „documenta“ mit einem Triptychon vertreten gewesen: Die vertikal aneinandergefügten Teile des Gemäldes, das heute im Kölner Museum Ludwig hängt, zeigen fast drei Meter hoch eine ebenfalls fast hüllen-, diesmal auch noch gesichtslose Dame als ergebene Wunscherfüllerin: Der Titel der Arbeit charakterisiert die Figur als bestmögliche Übereinstimmung mit dem klassischen feuchten Männertraum – als „Perfect Match“. Heute heißt so bei Nutzern und Nutzerinnen von Dating-Portalen der Volltreffer bei der Partnerinnen- oder Partnersuche. Dergleichen muss auch nicht entbehren, wer sich zwischen einer Verabredung und dem nächsten one-night stand Zeit für ein bisschen Kunst nimmt. Denn das Bode-Museum in Berlin hat vor wenigen Tagen die App „Perfect Match!“ freigeschaltet, mit der das weltweit renommierte Haus im Zeichen digitaler Totalvernetzung eine zeitgeistig-zeitgemäße Art der Publikumswerbung und Kunstpräsentation erprobt; in den Stores von Android und iOS ist das Programm, für das Studierende der Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald die Recherche leisteten und die Texte schrieben, kostenlos erhältlich. Macht das Beispiel Schule, so könnten in immer mehr Ausstellungen, Sammlungen und Galerien die faden Schrifttafeln mit Erläuterungen, sogar die weit beliebteren und gebrauchsfreundlicheren Audio-Guides ausgedient haben. Nun nämlich können die Nutzerinnen und Nutzer, ähnlich wie beim Swipen während der Online-Anbahnung, schon zu Hause aus einem Angebot von bisher zwanzig Exponaten des Museums auswählen. Was nicht gefällt, wird weggewischt. Mit den Objekten, die auf Interesse stoßen, eröffnet sich, wie es auf der Website der Staatlichen Museen zu Berlin heißt, die Gelegenheit zum „persönlichen Chat“ – vorausgesetzt, auch das Exponat ist an näherer Kontaktaufnahme interessiert. Dann berichtet, zum Beispiel, eine Statuette des Heiligen Patroklus, wie es ihr gelang, von Plünderern aus der Armee Napoleons verschont zu werden. Besonderes Interesse bekunden die Exponate verständlicherweise daran, den Interessenten irgendwann an Ort und Stelle persönlich gegenüberzustehen oder -zuhängen: „Vor Ort am Original“, teilt die Homepage mit, „kann der Chat dann vertieft werden – was sich als emotional, lustig, ernst oder einfach informativ erweisen kann.“ Die App solle „spielerisch Berührungsängste und Hemmschwellen abbauen, indem sie Objekten ein Gesicht gibt“. Die meisten besitzen freilich ohnehin längst eins, etwa Tilmann Riemenschneiders Evangelist Markus von 1492 oder Michel Erharts nur wenig jüngere „Muttergottes“. Beide, der entrückte Jesus-Biograf wie Maria mit dem Jesuskind, verhalten sich zudem sehr anders als die zwar divergenten, indes in Lüsternheit vereinten perfect matches des Tabubrechers Allen Jones: Sie haben was an, vom Hals bis zu den Knöcheln. ■
Unmögliche Kunst
19. November Die Oper, meinte der bedeutende Kulturpublizist Oskar Bie, sei ein „unmögliches Kunstwerk“. Natürlich bestritt er damit keineswegs ihre Existenz; ganz im Gegenteil: 1913 widmete er ihr ein noch heute gelesenes Buch. Doch war ihm bewusst, dass die Gattung mit dem alltäglichen Leben normaler, also nicht mit den Mitteln des Gesangs kommunizierender Menschen wenig zu tun habe; und er staunte darüber, dass die Oper – und vor der Erfindung des Films nur sie – in der Lage ist, von allen Künsten das Beste in sich amalgamierend aufzunehmen: Vokal- und Instrumentalmusik, Dichtung und Spiel, den Tanz und das Bild. Spätestens Richard Wagner erhob die unabsehbare Vielfalt dieses Potenzials zum Prinzip: Umfassend als „Musikdramen“ apostrophierte er seine großen Opern und konzipierte sie ausdrücklich als „Gesamtkunstwerke“. So auch porträtiert zurzeit die Bundeskunsthalle in Bonn die Gattung in einer Ausstellung: als „einmaliges und vergängliches“, jedenfalls „spektakuläres Gesamtkunstwerk“. Im vorangestellten Adjektiv schwingt das Widersprüchliche der Oper als zugleich „unmögliches“ wie real existierendes „Spektakel“ erhellend mit, erfüllt sie doch viele Bedeutungen jenes Worts, wie etwa der Duden sie angibt, mit staunenswerter Wendigkeit. Sie setzt darauf, mit ihrem Übermaß auseinanderstrebender Wirkungsmechanismen unterschiedliche Sinne gleichzeitig zu überwältigen, indem sie neben der Hörlust auch die Schaulust befriedigt (als ‚echter Hingucker‘, denn vom lateinischen spectare für ansehen rührt das Fremdwort her); um ihre Zwecke zu erreichen, scheut sie geschwollene Rührseligkeit und aufgeblasene Albernheiten nicht; jedenfalls strebt sie mit ihrer Ausdruckskraft danach, Geschichten bigger than life zu proklamieren, und will schon rein äußerlich als üppiges Event möglichst viel Publikum an sich binden. Das gelingt ihr nicht immer, aber in der Regel dann, wenn die sogenannten Schlachtrösser, die erprobten Groß- und Meisterwerke der fünf Gattungsgiganten Mozart, Verdi und Puccini, Wagner und Strauss auf dem Spielplan stehen. „Die Oper ist tot – es lebe die Oper!“ überschrieben die Bonner Kuratoren ihre Schau, und wirklich hält sich die über vierhundert Jahre alte Kunstform irgendwo zwischen imposanter Zeitlosigkeit und lachhafter Überalterung auf, in einem Mischzustand von Innovationsfähigkeit und Leichenstarre. Ob sie nicht letztlich „aus der Zeit gefallen“ sei, erörtert auch Andrea Petković, die einstige Profi-Tennisspielerin, die jetzt fürs Feuilleton der Zeit Kolumnen schreiben darf, in einer Erlebniserzählung in der jüngsten Ausgabe der Wochenzeitung. Auf der Suche nach „neuen körperlichen und emotionalen Herausforderungen“ besuchte sie, ihrer vornehmlich rockmusikalischen Sozialisation zum Trotz, sechzehn Stunden lang Dmitri Tchernjakows aktuelle Inszenierung von Wagners „Ring des Nibelungen“ in der Berliner Staatsoper. Dort fühlte sie sich bereits im „Rheingold“ ganzkörperlich von „einer Gänsehaut“ überzogen und erlebte in der „Götterdämmerung“ Siegfrieds Tod und Trauermarsch als „das vielleicht schönste Stück Musik, das ich jemals gehört habe“. Kurz, nach sechzehn Stunden langem „Leiden“: „Es ist grandios.“ Nach Petkovićs Evaluation darf man also beruhigt sein: Mag auch der berühmte Komponist und Dirigent Pierre Boulez schon 1967 im Spiegel gefordert haben, alle Opernhäuser in die Luft zu sprengen – dass dies demnächst geschieht, scheint ziemlich unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. ■
Klapperndes Handwerk
12. November Naturbelassen, so wie das Kochen, betrieb Günter Grass das Schreiben. Textverarbeitender Computertechnik verweigerte er sich, stets handschriftlich – wie Thomas Mann – setzte er vom Beginn seiner Karriere an seine teils sehr umfänglichen Werke auf. Dann erst tippte er sie auf einer Reiseschreibmaschine der Marke Olivetti ab. Als er begriff, dass mit dem Siegeszug des digitalen PC das von ihm bevorzugte, von Fall zu Fall nachgekaufte Modell „Lettera 22“ bald auslaufen würde, hamsterte er für den Rest seines Autorendaseins die letzten Exemplare – ein Bekenntnis zur Schriftstellerei als analogem Handwerk. Das alles scheint schon lange her und liegt doch gerade mal ein paar Jahre zurück. 2015, mit 87 Jahren, starb der Nobelpreisträger von 1999, ungefähr zu der Zeit, als die letzte mechanische Schreibmaschine auf Erden produziert wurde. Die Angaben schwanken: Verließ sie 2011 die Fertigungshallen eines indischen Herstellers? Oder wurde sie doch erst in Grass’ Todesjahr in Shanghai zusammengeschraubt? Umso eindeutiger lässt sich der historische Ursprung aller Modelle datieren: Den Prototyp präsentierte der Tiroler Peter Mitterhofer 1866 dem kaiserlichen Hof in Wien. Aus Holz, wohlgemerkt, hatte der gelernte Dorfzimmermann ihn fabriziert. Vor zwei Tagen erinnerte eine Sendung des Deutschlandfunks daran, dass Klappern auch zum Handwerk des Schreibens gehört. Das der Schreibmaschine, einst nervtötend, entbehren Akustik-Nostalgiker heute so schmerzlich wie etwa das wirre Rauschen aus dem Radiolautsprecher während der Suche nach einem passenden Sender oder das Kreischen der Kreide auf der Schultafel. Optischen Spezialitäten aus den Walzen- und Hebelwerken wendet sich zurzeit das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen in Berlin zu, wo Typewritings von Ruth Wolf-Rehfeldt zu sehen sind. Zwischen 1972 und 1989 schuf die heute 90-jährige Berliner Künstlerin, die in diesem Jahr den angesehenen Hannah-Höch-Preis erhält, eine beeindruckende Reihe von Grafiken, deren Motive sie mittels der unterschiedlichen Lettern von Schreibmaschinen artistisch zusammenpixelte und also zwischen Poesie und Bildkunst changieren lässt. Das Günter-Grass-Haus in Lübeck zeigt die lindgrüne Olivetti-Maschine, auf der die Reinschrift seines Romans „Die Rättin“ entstand. Seit 2017 beherbergt das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, das größte Computermuseum der Welt, eine vom Schriftsteller sogar signierte Olivetti „Lettera 22“ in derselben Farbe. Aus den Büros sind Schreibmaschinen längst verschwunden, auf Flohmärkten kann man ramponierte, in Antiquitätengeschäften besser erhaltene Exemplare kaufen, Sammlerstücke stehen in öffentlichen Sammlungen. Der vor sechshundert Jahren gelungenen Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gutenberg scheinen sie näherzustehen als dem Komfort moderner Textverarbeitung, die dem Verfasser erlaubt, schon vom ersten krausen Entwurf an sozusagen die Reinschrift seines Dokuments zu bearbeiten. Wer dabei auf den Look der fossilen Olivetti-, Adler- oder Olympiamodelle nicht verzichten mag, kann im Internet Lizenzen für Oldschool-Zeichensätze erwerben, die so schöne Namen tragen wie „Special Elite“ oder „Larabie Font“, „Cuomotype“ oder, nachgerade programmatisch, „Veteran Typewriter“. ■
Beängstigend hell
8. November Sogar einen Hund, ausdrücklich einen Pudel, hat Johann Wolfgang von Goethe in seiner „Faust“-Tragödie vorgesehen. Freilich betritt der Kläffer, wie jeder deutsche Gymnasiast zurzeit noch pflichtgemäß zu lernen hat, statt als Tier als Teufel die Szene: Der nämlich sei, heißt es im ersten Teil der Tragödie, „des Pudels Kern“. Zum Kerngeschäft der Bühnen gehört die Tierhaltung freilich nicht, was gleichwohl wiederum nicht ausschließt, dass auch andere animalische Spezies als der Mensch sich auf ihnen tummeln, und gar nicht mal so selten. In Zeiten vertiefter Sorge ums Tierwohl erheben denn auch gern Zeitgenossinnen und -genossen mahnend die Stimmen, um, gewiss zu Recht, nach den Möglichkeiten artgerechter Unterbringung zwischen den Kulissen zu fragen. So bekamen es die Verwaltungsgerichte in der Hauptstadt und Brandenburg dieser Tage mit Beschwerden von einschlägig sensibilisierten Besuchern der Berliner Staatsoper zu tun; sie hatten dort im Rahmen der Neuinszenierung von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ durch Dimitri Tscherniakow die beiden ersten Teile, „Das Rheingold“ und „Die Walküre“, gesehen und dabei an gestapelten Käfigen Anstoß genommen, in denen lebendige Kaninchen und Meerschweinchen zugange waren. Gerade diese Arten aber, warnte die Tierrechtsorganisation Peta, nähmen durch Stress leicht an der Gesundheit Schaden; überhaupt seien „Tiere nicht auf der Welt, um einem beängstigenden Szenario aus lauter Musik und hellem Licht ausgesetzt und als Zuschauerattraktion beliebig hin und her transportiert zu werden". Umgekehrt können Theaterleute auf lange Traditionen von Tieren auf der Bühne verweisen, die aus den Spielstätten noch lange keine Zoos haben werden lassen. Wie in einer Art Labor aber kann es durchaus zugehen: Unterm Titel „Balthazar“ ließ der Performance-Künstler David Weber-Krebs 2013 und 2014 in Brüssel, Hamburg und Amsterdam Menschen und einen – nicht eigens trainierten – Esel gemäß einer festgelegten Dramaturgie interagieren; den theoretischen Unterbau für das „künstlerische Forschungsprojekt“ schuf Dr. Maximilan Haas von der Berliner Universität der Künste, der es danach in einer wissenschaftlichen Monografie auch ausgiebig dokumentierte. Als vor vielen Jahren im Theater Hof bei Gelegenheit des Westernmusicals „Oklahoma!“ ein Darsteller auf einem leibhaftigen Ross auf die Bühne ritt, schrieb niemand ein Buch darüber; immerhin erhob der Rezensent der örtlichen Zeitung Einspruch, wenngleich nicht aus tierschützerischen, sondern künstlerischen Gründen. Solche erwogen bereits lange vor ihm weitaus erleuchtetere Geister. So musste es Goethe 1817 als Intendant des Weimarer Hoftheaters erdulden, dass gegen seinen Willen die - dem amtierenden Großherzog Carl August auch anderweitig gefällige - Schauspielerin Caroline Jagemann die Aufführung des seinerzeit beliebten Spektakels „Der Hund des Aubry“ von René Charles Guilbert de Pixérécourt durchsetzte. Der Dichter, Kötern so wenig zugetan wie Kritikern („Schlagt ihn tot, den Hund! Er ist ein Rezensent!“), ertrug nicht, dass in dem Dreiakter ein dressierter Pudel die Hauptrolle spielen würde. Hilflos gegen die diabolischen Machtmittel der zur Frau von Heygendorff geadelten Fürsten-Konkubine, legte er die Theaterdirektion protestierend nieder. Nach 26 Jahren? Bloß wegen einer Töle? Da liegt der Hund begraben: Auch auf der Bühne steckt der Teufel meistens im Detail. ■
Püree-Protestler
1. November Auf drei Wegen findet Kunst in die Weltgeschichte des Verbrechens. Zum ersten, und vor allem, durch illegale Kopien oder Imitate. Zum andern fühlen sich Diebe angezogen: Als berüchtigtster Coup gilt hier die zweijährige Entführung der „Mona Lisa“ aus dem Pariser Louvre im August 1911; seit vielen Jahren zählt Kunstraub, neben dem Drogen- und dem Waffenhandel, zu den lukrativsten Optionen, das Gesetz zu brechen. Zum dritten schlägt der Vandalismus in der Statistik gehörig zu Buche. Derlei Attacken können sich sowohl punktuell ereignen als auch weiträumig: im Zug von ausgreifenden Bilderstürmen, wie während der Reformationszeit; auf Befehl von Tyrannen, wie bei der Vernichtung „entarteter Kunst“ durch die Nationalsozialisten; im Verlauf von Konflikten, wie von 2015 bis 2017, als Fanatiker des „Islamischen Staats“ das syrische Weltkulturerbe Palmyra zerstörten. Aus der Ukraine kommen zurzeit ähnliche Schreckensmeldungen: Seit die russische Armee das Land mit Putins barbarischem Angriffskrieg überzieht, seien dort bei Kämpfen oder durch Direktangriffe etwa vierhundert Museen geplündert oder ruiniert worden, desgleichen 270 Gotteshäuser und Monumente, mahnte unlängst der Internationale Museumsrat. „Was die Besatzer tun, ist Entukrainisierung. Sie wollen alles vernichten, was in der Ukraine von der Ukraine zeugt“, klagte Serhij Zhadan, seit vorvergangenem Sonntag Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, in einem Facebook-Video. Die Unesco, so versicherte inzwischen Maria Böhmer als Präsidentin der deutschen Kommission, sieht die Lage dort kaum weniger dramatisch. Wo Ikonoklasmus – wie das Fachwort für dergleichen Frevel lautet – Kunst in Trümmer legt, in Fetzen reißt oder zu Asche verbrennt, ist immer die Ausschaltung einer eigenständigen Kultur, mithin die Eliminierung eines Identitätsgefühls das Ziel. Immer? Im Potsdamer Museum Barberini klebten sich kürzlich zwei Klimaschützer der Gruppe „Letzte Generation“ neben einem der „Getreideschober“-Bilder Claude Monets fest; zuvor hatten sie das Gemälde des französischen Impressionisten beschmiert – „mit einer zähflüssigen Substanz“ von unbestimmter Schädlichkeit, wie eine Sprecherin zunächst mitteilte, mit harmlosem Kartoffelbrei, wie die Aktivisten schließlich versicherten. Ein paar Tage zuvor, in Londons Nationalgalerie, hatten zwei junge Damen mit wildentschlossenen Gesichtern, unter der auf ihre T-Shirts gedruckten Devise „Just stop Oil“, ein Sonnenblumenbild Vincent van Goghs mit Tomatensauce aus zwei Dosen begossen, bevor sie sich gleichfalls mit Sekundenkleber an der Wand verankerten. Beide Bilder ruhen sicher hinter Glas. Um Zerstörung ging es den Püree-Protestlern und Tomaten-Terroristen auch gar nicht, vielmehr, im Gegenteil, um Bewahrung: um die Erhaltung einer lebensfähigen Umwelt durch ein Ende der Erderwärmung. Fragwürdig die Mittel, zweifellos; aber geheiligt werden sie doch irgendwie durch den nicht weniger unzweifelhaften ‚guten Zweck‘, dem sie im Interesse der Menschheit dienen sollen. Die verschütteten Lebensmittel haben vielleicht der grassierenden Gleichgültigkeit, doch sicher nicht den Bildern Schaden zugefügt. In den Museen und der Politik gibt man sich, zu Recht natürlich, hellauf empört. Kollegen in der Ukraine oder Syrien aber winken höchstwahrscheinlich bitter ab: Wenn ihr sonst keine Probleme habt … ■
Vierzig fehlen
24. Oktober Totgesagt wird das Kino seit der Erfindung des Fernsehens. Bekanntlich blieb es trotzdem am Leben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Kino, als öffentliches Ereignis wie als Schauplatz, dem Theater mindestens so nahesteht wie die beliebig daheim konsumierbare Television. Allerdings galt dies nur ‚bis Corona‘. Schon im Juni 2020 – als in vielen noch die Hoffnung blühte, von einer zweiten, dritten und weiteren Wellen verschont zu bleiben – begannen sowohl kleine Häuser als auch große Ketten, sich ernstlich um ihre Existenz zu sorgen. Bereits damals gab es Gründe, zu befürchten, auch ‚nach Corona‘ würden die Filmfreunde lieber zu Hause schauen. Und so kam es. Zwar öffnen Lichtspiel-, wie Theater- und Konzerthäuser, ihre Tore zurzeit uneingeschränkt; gleichwohl bekräftigte Christine Berg, die Vorsitzende des Kinoverbands HDF Kino, die Filmwelt im Lande dürfe sich mit dem aktuellen Zuspruch keineswegs begnügen: „Sechzig Prozent der Besucher sind zurück“, sagte sie im Juli dem Redaktions-Netzwerk Deutschland, „an den letzten vierzig Prozent müssen wir noch arbeiten.“ Vom morgigen Dienstag an laden die Internationalen Filmtage zum 56. Mal nach Hof ein, wo sich das Team um Thorsten Schaumann ausdrücklich hoffnungsvoll zeigt, strömten doch 2021 zehntausend Gäste in die Säle des Central- und des Scala-Kinos, obwohl die nur zur Hälfte belegt werden durften. Auch blieb die Zahl der Premieren konstant; und nicht zuletzt bewährte sich neuerlich die Online-Nebenschiene: ein imponierendes Streaming-Programm und, wichtiger noch, das Angebot, fast alle Filme während des Festivals und weitere sieben Tage lang via Internet abrufen zu können. Da muss einem, angesichts der sich womöglich doch entspannenden Pandemie-Lage, für die Neuauflage nicht arg bange sein: In etwa 250 Vorführungen werden ungefähr 130 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen sein, vielfach von Regisseuren und Produzentinnen selbst präsentiert, im Fall der deutschsprachigen Produktionen, denen in Hof stets das Hauptinteresse gilt, oft in Anwesenheit von Hauptdarstellerinnen und -darstellern. So viel Ehrgeiz, Unermüdlich- und Unerschrockenheit wie im beschaulichen „Home Of Films“ kann und sollte die Branche insgesamt ermutigen, und wirklich hat sie, wie es scheint, zumindest auf den Festivals der Großen wie der Kleinen, der Generalisten wie der Spezialisten wenig Anlass zur Klage. Am 8. Oktober ging das Filmfest Hamburg zu Ende, dessen über hundert Filme 41.500 Menschen sehen wollten und das heuer zudem das bedeutendste ukrainische Festival, Molodist aus Kiew, zu Gast hatte. Sogar 137.000 Besucher warens binnen elf Tagen bis zum 2. Oktober beim achtzehnten Zurich Film Festival – Rekord. Mit bescheidenen 1500 Besuchern waren die Organisatoren der am 15. Oktober beschlossenen neunzehnten „Provinziale“ in Eberswalde zufrieden: immerhin ein Zuwachs. Am gestrigen Sonntag endeten sowohl das namhafte Tegernseer Bergfilm-Festival als auch das winzige, lateinamerikanische „Mira“-Festival in Bonn-Beuel. Noch bis zum Mittwoch zeigt das „Queer-Streifen-Festival“ in Regensburg schwule, lesbische und eben queere Streifen. Also alles in Ordnung? Vielleicht auch nicht. Eine aktuelle „Tacho“-Onlinegrafik von Opinary weist Ernüchterndes aus. Die Berliner Meinungsforscher wollten wissen: „Werden Kinos in der Zukunft aussterben?“ An die Option „Nein, das Kinoerlebnis bleibt unersetzlich“ glaubt leider nicht mal mehr die Hälfte der Befragten. ■
Rosa Sterne
20. Oktober Wer von uns kennt nicht wenigstens einen ausgemachten Holzkopf? Wem treibt nicht schon mal ein Granitschädel durch seine Borniertheit die Zornesröte ins Gesicht? Wer ist noch nicht gegen die Ignoranz eines Betonkopfs wie gegen eine Wand gelaufen? Wem bleibt die Erfahrung erspart, dass sich eine Matschbirne nicht für Geld und gute Worte zur Vernunft bringen lässt? Und wie gern gäben wir dem einen oder anderen Torfkopf unter uns eins auf die Rübe! Glaubt man dem Redensarten-Reservoir unserer Sprache, so kann ein menschliches Haupt aus sehr unterschiedlichen Substanzen bestehen. Mit Edelsteinen und -metallen hingegen bringen wir es kaum je in Verbindung. Dergleichen blieb dem Briten Damien Hirst vorbehalten: Vor fünfzehn Jahren machte der Künstler von sich reden, als er einen alten echten Schädel in Platin abgoss und die sündteure Kopie mit 8601 Diamanten erster Güte überzog. „For the Love of God“ heißt das stark umstrittene, schon deshalb vielbesprochene Kunstwerk, das angeblich noch im Entstehungsjahr für hundert Millionen Dollar einen Käufer fand; heuer räumte sein Schöpfer ein, es in Wahrheit immer für sich behalten zu haben. Der Titel des Artefakts geht auf eine englische Redensart zurück, die unserem deutschen „Um Himmels willen“ entspricht. Und ebenjener, der gestirnte Himmel über uns, beweist, dass uns selbst 8601 lupenreine Karfunkel, vom galaktischen Blickpunkt aus, nicht beeindrucken müssen. Teilte doch 2012 ein amerikanisch-deutsches Astronomenteam mit, ganz in der Nähe, nur viertausend Lichtjahre von uns entfernt, in der Milchstraße einen Planeten aufgespürt zu haben, der größtenteils aus Diamant besteht, mithin aus nichts Edlerem als extrem verdichtetem Kohlenstoff. Einst war der Himmelskörper ein Stern gewesen; seine Explosion als Supernova hat aber nur jener äußerst massereiche Kern überstanden. Der Versuch, den irdischen Materialwert der kosmischen Ruine von der halben Größe des Jupiters hochzurechnen, wäre müßig, aber reizvoll – zumal wir als Grundlage den Erlös hernehmen dürften, den vor einigen Tagen bei einer Auktion in Hongkong der 11,15 Karat schwere „Williamson Pink Star“ erbrachte: Seine eher leichtgewichtigen 2,23 Gramm waren einem schwerreichen Käufer aus Florida etwa 59 Millionen Euro wert. Die astronomische Wertschätzung verdankt der Klunker nicht zuletzt seinem seltenen Kolorit: Wie der Name sagt, schimmert er wie ein „rosa Stern“. Ein Namensvetter – allerdings mehr als fünf Mal so groß – war 2013 sogar für knapp 84,3 Millionen Euro gut. Muss, wer solchen Preis zahlt, ein Holzkopf, eine Matschbirne sein? In Blumenform zierte der "Williamson Jonquil pink Diamond", eine Brosche in Blumenform aus den unbezahlbaren britischen Kronjuwelen, gelegentlich die royalen Outfits der Queen Elizabeth. Desgleichen prunkt ein Brillant in der Luxusfarbe auf Damien Hirsts Glitzerschädel, noch dazu auffällig auf der Stirn. Aber auch Normalsterbliche mit durchschnittlichem Einkommen begegnen „Pink Stars“ in mancherlei Gestalt: Ein Hersteller von Schuhen und Handtaschen nennt sich so, eine Esoterikerin namens Rosa Stern schwurbelt vier Taschenbücher lang über die angeblichen Weissagungen des Nostradamus, Pflanzenfreunde können im Zimmer ein Aronstabgewächs der Gattung Aglaonema, im Garten eine Tulpe ziehen, beide unter besagter Bezeichnung. Und am Firmament verstrahlt ein Gasnebel von verblüffender Form das einschlägig gefärbte Himmelslicht eines Sternhaufens: wie eine Rose im Kosmos. ■
Kunst? Muss nicht sein
15. Oktober Schüsse fallen nicht. In Kürze aber wird ein Panzer nahe der Botschaft Russlands in Berlin vorfahren. Genauer: Er wird vorgefahren werden. Denn das demolierte russische Kettenfahrzeug hat im Ukrainekrieg selbst reichlich Schüsse abbekommen. Menschen fanden den Tod darin. Auch aus diesem – moralisch bedenkenswerten – Grund hatte das Bezirksamt Mitte im Juni das Kunstprojekt des Museums „Berlin Story Bunker“ zunächst verboten, zumal es sich, wie das Amt meinte, auch gar nicht um Kunst handle. Dieser Tage indes ließ das Verwaltungsgericht die Aktion zu: Zwei Wochen lang dürfe das vierzig Tonnen schwere Kriegsgerät in einer Absperrung stehen. Als Mahnung zum Pazifismus ist solch ein Vorhaben grundgesetzlich durch die hierzulande (nicht aber in Russland) geltende Meinungsfreiheit geschützt. Um Kunst, so das Gericht, müsse es sich dabei gar nicht handeln. Werden demnächst tschechische Panzer auch durch Kaliningrad rasseln? Könnte passieren – wenn man dem Internet glaubt: Freudetrunken teilt eine bunte Website mit, 97,9 Prozent der Bevölkerung im weiland ostpreußischen Königsberg hätten dafür gestimmt, dass Tschechien die russische Exklave zwischen Polen und Litauen annektiere und in Královec umbenenne. 600 Kilometer Luftlinie, mindestens 920 Autokilometer liegt das Territorium von Prag entfernt, dennoch knattert auf dem Majak, einem Aussichtsturm und Wahrzeichen der Stadt, die Fahne der tschechischen Republik verwegen im Wind, und im Hafen liegt wehrhaft deren Flugzeugträger „Karel Gott“ vor Anker, wie Fotos belegen. Gefakte Fotos: Denn natürlich ist all das Satire. Zu den dafür verantwortlichen Aktivisten gehört der Historiker Michal Stehlik, der Russlands Macht-Eliten als Inspirationsquelle lobt: „Sie haben uns durch ihren kreativen Umgang mit Geschichte inspiriert.“ Wie inspiriert Kunst mit dem Thema Krieg umgeht, und zwar in allem Ernst, das machen derweil Exponate von Albrecht Dürer bis Gerhard Richter im schweizerischen Winterthur sichtbar. Bis zum 12. Februar zeigt das dortige Kunstmuseum, in einer Schau der Sammlung „Reinhart am Stadtgarten“, freilich keine heroischen Glorifikationen von Sieg und Unbesiegbarkeit im Dienst nationalistischer Propaganda, vielmehr das Gegenteil: zum Beispiel die berühmten Grafiken des Spaniers Francisco de Goya über die „Schrecken des Krieges“, oder die Blätter des Franzosen Jacques Callot über „Elend und Unglück des Kriegs“. „Los Desastres de la Guerra“, „Les Misères et les Malheurs de la Guerre“: Zu Recht bezeichnet das Museum Serien wie diese als „Meilensteine und Wendepunkte“ in der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem furchterregend unvermeidlichen Thema. Vielfach verhaltener, aber gleichfalls in meist kleinen Formaten haben ukrainische Illustratorinnen und Illustratoren buchstäblich auf–gezeichnet, was sie seit dem 24. Februar in ihrem von Russlands Imperialismus heimgesuchten Land erleben und empfinden. In dem Band „Bilder gegen den Krieg“, den das Berliner Stadtmagazin Tip im Schaltzeit-Verlag veröffentlichte, findet sich neben vielen anderen ein Blatt von Anya Sarwira: Vor schwarzem Grund hält eine Faust ein Kreuz hoch, an dem eine verendete weiße Taube mit Stricken in Weiß-Blau-Rot festgebunden ist, den Farben der russischen Flagge, mit einem eingeschnittenen blutroten „Z“ auf der Brust, dem Schrecksymbol auf Putins angreifenden Panzern. Propaganda? Mag sein, aber eine für den Frieden. Und Kunst? Auf jeden Fall. ■
Nichts Neues
27. September Als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, war der „Untergang des Abendlandes“ in seiner alten, aus dem verlängerten neunzehnten Jahrhundert überkommenen Gestalt besiegelt. Oswald Spengler, Verfasser der berühmten kulturhistorischen Studie unter jenem schlagwortartigen Titel, deklarierte um 1920 das unheilvolle Datum zum „größten Tag der Weltgeschichte“. Solch absurd frenetischer Auffassung widersprach neun Jahre später der vom Krieg traumatisierte Journalist Erich Maria Remarque in seinem Bestseller „Im Westen nichts Neues“. Mit reportageartiger Schonungslosigkeit rollt er darin die Entsetzlichkeiten des menschenverschlingenden Stellungskriegs auf. Schon im Jahr darauf kam Lewis Milestones Verfilmung in die US-Kinos, ein weiteres Jahr später (und um drei Viertelstunden gekürzt) auch in die deutschen. Joseph Goebbels, bald darauf der plärrende „Reichspropagandaminister“ Adolf Hitlers, leitete völkische Schlägertrupps zu Krawallaktionen in den Lichtspielhäusern an. Als Remarques Roman noch 1933, im Jahr der braunen „Machtergreifung“, auf den Scheiterhaufen der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen landete, konnte ihm selbst das nicht den Garaus machen; im Gegenteil. Derart geadelt, steht er heute im Ruf, eine der Inkunabeln des „Kriegsbuchs“ zu sein – schlechthin das Antikriegsbuch in deutscher Sprache. Zwei Oscars heimste Milestones Leinwandversion von 1930 ein. Heuer ist „Im Westen nichts Neues“ neuerlich für einen Academy Award, nämlich den Auslands-Oscar, nominiert – in der von Edward Berger inszenierten deutschen Adaption, die, nach der Uraufführung am 12. September beim Toronto International Filmfestival, ab Donnerstag in ausgewählten Kinos in Berlin und Hamburg, Stuttgart und Gauting gezeigt wird, bevor Netflix sie vom 28. Oktober an seiner Klientel online offeriert. Aber sagt „ein Bild“, also der Film, wirklich mehr als viele tausend Wörter? Am 24. Februar, Wladimir Putins „großem Tag“, an dem er die Ukraine überfallen ließ, mussten auch die Deutschen einsehen, dass Krieg sich sogar in Europa als anthropologische Konstante hartnäckig behauptet: „nichts Neues“. Wer darüber erschrak, wird auch über Remarques Roman und andere pazifistische „Kriegsbücher“ erschrecken, deren Lektüre freilich eben darum gerade jetzt wieder lohnt: etwa über Arnold Zweigs ab 1926 erschienenen sechsbändigen Zyklus über den „Großen Krieg der weißen Männer“, oder über Edlef Köppens „Heeresbericht“ von 1930, der rund um die Erlebnisse seines soldatischen Antihelden zahllose Originaltöne aus „großer Zeit“ montiert, kommentiert und konterkariert. Als der populäre Heimatromancier Ludwig Ganghofer 1915 an die Front reiste, fiel ihm dort „immer ein fernes Pfeifen in der Luft“ auf; „von der Tiefe des Feldhanges klingt ein lustiges Knallen herauf, als ständen da drunten die Schießstätten des Münchner Oktoberfestes.“ Das Völkergemetzel als Volksbelustigung: ein Mords-Spaß. Karl Kraus, legendärer Wiener Publizist und zwischen 1915 und 1922 Verfasser eines galligen, achthundert Druckseiten starken Dramas über „Die letzten Tage der Menschheit“, mahnte hingegen: „Kriegsmüde hat man zu sein nicht nachdem, sondern ehe man den Krieg begonnen hat.“ Die Bücher von Remarque, Zweig, Köppen und manch anderen können einen im krausschen Sinne müde machen, indem sie einen hellwach halten. Also wohl doch lieber Originalliteratur als Verfilmungen: Ein guter Roman sagt mehr als tausend Bilder. ■
Zeichen und Wunder
24. September Das Wort Geheimnis hat einen magischen Klang, der das Interesse anstachelt, zur Neugier verführt, mit Wunderbarem rechnen lässt. Die Sache selbst freilich, das Insgeheime, Verdeckte und Verschlossene, kann einem auch gehörig schaden. Zwar sind brisante Inhalte, die im Internet von einem Server zum andern wechseln, verschlüsselt unterwegs, sodass Unbefugte sie nicht auslesen und missbrauchen können. Im Gegenzug indes entwickeln Online-Schurken raffinierte ransomware, Schadprogramme, mit der sie die Daten eines gekaperten Rechners unkenntlich machen, um sie erst gegen Zahlung eines Lösegelds wieder freizugeben. Zweifellos ein Akt hoher krimineller Energie; faszinierend aber ist sie schon, die Möglichkeit, eine Schrift, mit der wir unsere Ideen und Informationen aufbewahren und mitteilen, zur Geheimschrift zu verfremden, mit der sich nur mehr eine verschworene Gemeinschaft Auserwählter über Klammheimliches, Konspiratives, Kryptisches verständigt. Kryptografie heißt denn auch die Kunst, solche Zeichensysteme zu erschaffen oder ins Allgemeinverständliche zurückzuführen. Der US-amerikanische Dichter Edgar Allan Poe behauptete 1839 öffentlich, er sei in der Lage, alle monoalphabetischen Geheim- oder (wie er es nannte) „Hieroglyphenschriften“ zu knacken, alle also, „bei denen anstelle von Buchstaben des Alphabets jede Art von Zeichen willkürlich verwendet wird“. Vier Jahre später führte in Poes Erzählung „Der Goldkäfer“ der fiktive Meisterkryptologe Legrand seine Methode der – eher simplen – Häufigkeitsanalyse beispielhaft am Code auf einer Schatzkarte vor. Seit etwa sechstausend Jahren kennt die Menschheit Schriften; nicht viel weniger alt sind Dokumente aus dem alten Ägypten, auf denen Priester religiöses Geheimwissen verschlüsselten. Dabei galt das um 2700 vor Christus entstandene, für dreitausend Jahre unveränderte Schriftsystem des Reichs am Nil selbst als schier unlösbares Geheimnis – bis zum 27. September 1822. Am kommenden Dienstag vor zweihundert Jahren wurde publik, was Experten sofort für ein Wunder hielten: Der erst 31-jährige französische Sprachforscher Jean-François Champollion teilte der Académie française mit, ihm sei die Entzifferung der vermeintlichen Bilderschrift gelungen. Die gar keine ist, wie er als Erster durchschaut hatte, sondern (mit seinen Worten) „ein komplexes System, bildhaft, symbolisch und fonetisch zugleich, und zwar in ein und demselben Text, ein und demselben Satz, sogar in ein und demselben Wort“. Hatte er doch die alten Siglen als Symbole teils für komplette Nomen und Verben, teils für einzelne Laute, teils als stumme Signale erkannt. Aufklären konnte er das uralte Rätsel, weil 1799 während Napoleons Ägyptenfeldzug ein Offiziere nahe der Hafenstadt Rosetta, dem heutigen Rashid, eine Basaltplatte mit dreierlei Aufschreibungen gefunden hatte: sowohl in Hieroglyphen als auch in einer Art ägyptischer Schreibschrift, zudem in griechischen Lettern. Bereits 1814 ahnte der Brite Thomas Young, es könne sich beim Inhalt des (196 vor Christus gemeißelten) pierre de Rosette um immer dasselbe königliche Dekret handeln. Darauf aufbauend, gelangen Champollion, der mit erst zwanzig schon Professor für Ägyptologie in Grenoble gewesen war, in jahrelanger Knobelarbeit schließlich die entscheidenden Aufschlüsse. An den computergenerierten Codes von heute hätten sich allerdings auch er und Young, Poe und dessen Superhirn Legrand die Zähne ausgebissen. ■
Sechs Farben
17. September Die berühmten „Quadrate“ des russischen Malers Kasimir Malewitsch sind das Gegenteil zum Teletext: das „Schwarze Quadrat“ von 1915, erst recht das zwei Jahre jüngere „Weiße Quadrat auf weißem Grund“. Unumwunden verraten die Titel solcher radikal gegenstandslosen Konzeptionen das Wenige, was auf ihnen zu erblicken (und das Viele, das in sie hineinzuinterpretieren) ist. Der Künstler selbst nannte sie „die nackte[n] Ikone[n] meiner Zeit“. Hundert Jahre später sah der Wiener Kurier darin den „absoluten Nullpunkt“ der Kunst erreicht, was nicht abschätzig gemeint war. Aktuell erlaubt eine eigentümlich verwandte Kunstdarbietung noch ein paar Tage lang, Malewitschs die Moderne prägenden Schöpfungen sehr zeitgemäß zu deuten: als ein aufs Riesenformat von knapp achtzig mal achtzig Zentimetern vergrößertes Pixel. „Teletext ist Kunst“: So selbstbewusst heißt seit Monatsanfang eine im medialen Raum des Bildschirms gezeigte Schau, für deren Präsentation sich ARD Text und ORF Teletext sowie die Künstlerkollektive FixC und TeleNFT zusammengeschlossen haben. Noch bis zum kommenden Mittwoch wollen, angeführt von dem Deutschen Max Haarich und Gleb Divov aus Litauen als Kuratoren, fünfzehn Künstlerinnen und Künstler vornehmlich aus Deutschland nachweisen, dass sich auch innerhalb des extrem beschränkten televisionären Teletext-Rasters veritable Bildkunst komponieren lässt: aus nur 78 mal 69 Pixeln in nur sechs Farben zuzüglich Schwarz und Weiß. Auf insgesamt 67 Arbeiten lässt sich Abstraktes und Gegenständliches, Ironisches und Irritierendes mal staunend, mal kopfschüttelnd betrachten. Unüberschaubar das potenzielle Publikum: Allein in Deutschland nutzen täglich zehn Millionen Menschen den mehr als vierzig Jahre alten, technisch fast unveränderten, mithin angeblich aus der Zeit gefallenen Service der Öffentlich-Rechtlichen. Sogar erwerben kann man die Exponate – als NFT. Eine künstlerische Online-Datei nennt man so, die zwar von jedermann eingesehen und downgeloadet werden kann, aber dank eines Zertifikats dem Käufer als Eigentum eindeutig zugewiesen ist. Zahllose kleine Glieder, planmäßig so angeordnet, dass sie für Auge und Sinn eine bildhafte oder grafische Einheit ergeben: Die Idee ist fast so alt wie die Kunst. In Mosaiken bleibt sie Jahrtausende hindurch erhalten, im Pointillismus des fin de siècle, etwa bei Georges Seurat, avancierte sie zur malerischen Methode, als Puzzle hilft sie dem Müßigen, die Zeit totzuschlagen, über die Stickrahmen der Mütter und Großmütter fand sie als Kreuzstich Eingang in die häusliche Handarbeit – und ist so auch wieder in der Teletext-Ausstellung, durch ein Werk von Mario Klingemann alias Quasimondo vertreten. Zum unentbehrlichen Informationsträger und Kommunikationsmittel in der Logistik brachte es der quadratische, schwarz-weiß gepixelte und darum elektronisch blitzschnell lesbare QR-Code. Einen solchen offeriert in der digitalen Schau der Kölner Bloom Jr. all jenen, die nicht nur die vom Teletext bereitgestellten vier, sondern sämtliche Versionen seines Opus „8Monroe“ besichtigen wollen. All diese Darstellungen, aus Kleinstelementen planvoll zusammengesetzt, bestätigen die Erkenntnis des Aristoteles, es sei das Ganze stets mehr als bloß die Summe seiner Einzelteile. Nur für Malewitschs „Quadrate“ scheint dies nicht zu gelten: In ihnen fallen Teil und Ganzes in eins. ■