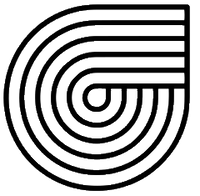Eckpunkte-Archiv 2023/24
Nun aber fix
13. Juli Wir sollten geduldiger sein. Die Schöpfung ist ein ewiger Prozess, alles in ihr braucht seine Zeit, viel Zeit. Auch heute dürfen wir den antiken Philosophen vertrauen, die durchschauten, dass „die Natur keine Sprünge macht“, natura non facit saltus. Und schickt sie sich doch zu einem Hüpfer an, so reicht der schon mal zehn Millionen Jahre weit. Aus dem Blickwinkel der Ewigkeit, sub specie aeternitatis, nicht mal ein Wimpernschlag: Ungefähr so lang oder kurz dauerte die „Kambrische Explosion“ der Tierarten vor gut 540 Millionen Jahren – gleichsam schlagartig brachte die Evolution damals binnen zehn Jahrmillionen nahezu alle uns heute bekannten zoologischen Stämme hervor. Die Menschheit freilich „macht Sprünge“. Auch in der Evolution ihres Fortschritts zündete eine Explosion – zu Beginn der 1950er-Jahre ereignete sie sich und hält als „Große Beschleunigung“ seit nunmehr einem Dreivierteljahrhundert, immer eiliger werdend, an. Zur Zeit der Renaissance hätte sich das universelle Faktenwissen physisch vollständig in leidlich kleinen Sammlungen von Schriften aufbewahren lassen, symbolisch gesprochen: in einer nicht allzu langen Reihe von Bücherschränken. Seither indes vervielfachte es sich unablässig, und nie in solchem Maß wie während der besagten jüngsten 75 Jahre. Während die Weltgemeinschaft der Forschenden in den Fünfzigern jährlich etwa hunderttausend Fachbeiträge publizierte, bringt sie es heute auf mehrere Millionen Jahr für Jahr. Einst waren auf allen Datenspeichern zusammengenommen – namentlich auf Lochkarten und Magnetbändern – einige wenige Milliarden Zeichen (also Gigabyte) hinterlegt; eine lächerlich verschwindende Menge, verglichen mit den etlichen Exabytes oder Milliarden Milliarden Zeichen, die auf heutigen Servern liegen. Wenn die Gelehrten noch bis vor hundertfünfzig Jahren die Welt vor allem in der Horizontalen, an ihren Oberflächen, durchforsteten und -forschten, so bohren sich die Genies von heute, bildlich gesprochen, vertikal kilometerweit in die Tiefen; was sie dort ergründen, ist so spezialisiert und fokussiert, dass es sich selbst den interessiertesten Laien unter uns kaum begreiflich machen lässt, zumal es dafür eines Fachjargons bedarf, der den Bereich breitentauglicher Kommunikation weit hinter sich lässt. Die Entwicklung der Schrift, die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, die Fähigkeit, Elektrizität zu erzeugen und zu nutzen, die Formulierungen der Relativitätstheorien durch Albert Einstein … – alles geradezu anomale Vorkommnisse in der Geschichte, von denen jedes einzelne der Entfaltung des menschlichen Geistes eine kopernikanische Wende bescherte. Anfangs lagen zwischen derlei Schwellenübertritten ganze Epochen, wenn nicht Jahrtausende, schließlich wenigstens mehr als ein Jahrhundert; hingegen hat, wer heute zwischen siebzig und achtzig Lenze zählt, mit den ersten Großrechenanlagen, dem Internet und der „Künstlichen Intelligenz“ binnen eines einzigen Menschenalters gleich drei solcher historischer Grenzüberschreitungen miterlebt. Geht dies alles nicht – um mit Woody Allen zu sprechen – „um eine Terz zu geschwind“? Wer angesichts so augenfälliger Anhaltspunkte für eine „Große Beschleunigung“ befürchtet, mit dem eigenen hellen und doch so beschränkten Köpfchen über kurz oder lang aus der nächsten Kurve der globalen Geistesexpansion getragen zu werden, hat von uns Leidensgenossen verständnisinnigen Trost und geduldigen Zuspruch verdient. ■
Lost in Space
25. Juni Schwund ist immer. Für ein Glück dürfen wir halten, dass ein Großteil dessen, womit wir in unserem Leben umgehen, uns irgendwann abhandenkommt. Andernfalls wären unsere ohnehin überladenen Behausungen längst aus allen Nähten geplatzt. Gleichwohl schmerzen uns Verluste, und bei weitem nicht erst der eines lieben Menschen. Kann sein, wir greifen bei einem Geldgeschäft daneben und büßen mehr ein, als wir gewinnen wollten. Oder ein Flegel fährt den Rückspiegel unseres Autos ab, eine Bagatelle zwar, aber eine ärgerliche, die uns zwingt, das Teil kostspielig zu ersetzen. Gern trauern wir erst recht den Illusionen unserer kindlichen Unschuldsjahre nach, den goldenen Hoffnungen und fantastischen Plänen, süßen Fehleinschätzungen und Arg- und Ahnungslosigkeiten, die wir uns, Stück für Stück, Jahr um Jahr abschminken mussten. Wie oft auch fühlen wir uns verloren: nicht gleich unausweichlich vom Tod bedroht, doch immerhin ratlos, alleingelassen, abgeschoben. Zu den peinsamen Konstanten jedes Menschenlebens gehören Einbußen, Defizite, Aderlasse, weswegen wir das Trierer Stadtmuseum im Simeonstift dazu beglückwünschen dürfen, das Thema nicht aus den Augen verloren zu haben. Zurzeit bereitet es eine Ausstellung mit Ausschussware unseres Alltagslebens vor: Am 7. Juli soll sie eröffnet werden, bis zum 27. Oktober zu sehen sein und „Ausrangiert“ heißen. Gemeinsam ist den abgelegten, ausgemusterten, zwischengelagerten Gegenständen, dass sie oft lange irgendwo herumliegen oder -stehen, bevor wir es übers Herz bringen, sie fortzuwerfen. Wofür müssen wir, unter solchem Blickwinkel, prähistorische Megalithen wie Menhire, Steinsetzungen wie Stonehenge halten? Um eindrucksvolle, aber sinnlos gewordene Abfallprodukte der Geschichte? Oder die geheimnisvollen Metallstelen, von denen – ganz aktuell – jetzt wieder eine auftauchte, im US-Bundes- und -wüstenstaat Nevada beim 2100 Meter hohen Gass Peak, einem etwa dreißig Kilometer vom Zockerparadies Las Vegas entfernten Gipfel? Hier spiegeln die glatten Oberflächen der viereckigen, etwa zwei Meter hohen Säule reizvoll die weit und breit abgestorbene Landschaft. Bei weitem nicht der erste Fund: Vor vier Jahren ragte in Utah ein ganz ähnliches Gebilde auf, dann in Großbritannien, in den Niederlanden … - bei Neuschwanstein sogar. Niemand ahnt auch nur, was die Artefakte da verloren hatten und ob sie noch einem anderen Zweck dienten außer dem, uns zu verblüffen und ästhetisch anzusprechen. Vor allem: Wer stellte sie auf? Natürlich fühlen sich Kinokenner des Science-Fiction-Genres alarmiert: kennen sie doch Objekte der besagten Art aus Stanley Kubricks Meisterwerk, dem US-Klassiker „2001 – Odyssee im Weltraum“, der Maßstäbe setzte, indem er Kosmologie, Menschheitsgeschichte und Metaphysik gleichermaßen umfasste. Wirklich steht für Ufologen fest: Nur Besucher aus den Weiten des Alls können die Zeichen zurückgelassen oder eingebüßt haben. Doch was sie uns mitteilen (oder antun) sollen, vermögen selbst fantasievolle Alien-Jünger bestenfalls zu vermuten. Womöglich hilft bei der Analyse die Einteilung der Trierer Ramsch- und Reste-Schau: Haben wir die Rätseldinger eher dem Bereich „Wohnen und Haushalt“ oder „Arbeitsalltag“ zuzuordnen? Oder „Medizin"? Oder „Körperpflege“? Und dürfen wir sie entsorgen? Eigentlich kann uns der Kram gestohlen bleiben, aber vielleicht brauchen ihn die Außerirdischen ja noch. ■
Kulturgut Fußball
14. Juni Dünkelhafte Zeitgenossinnen und -genossen könnten unlängst einen Kulturschock erlitten haben, als sie erfuhren: Der Nachlass Sepp Herbergers wird fortan im „Verzeichnis national wertvollen Kulturguts“ geführt. Unter die Kategorie fällt, was die Besten unter uns an Bedeutendem von zeitloser Ausstrahlung hervorgebracht haben und was darum beanspruchen darf, als vorbildlich wertgeschätzt und gehütet zu werden. Inwieweit dies im Einzelnen auf Herbergers Hinterlassenschaft zutrifft, wäre detailliert zu untersuchen; freilich schallt noch 47 Jahre nach seinem Tod wie Donnerhall sein Ruf als Bundestrainer jener Fußballnationalmannschaft, die er 1954 zu ihrem ersten Weltmeistertitel führte. In über zweihundert Kartons, so meldeten die Medien, seien seine Souvenirs, zudem 4600 Bilder eingelagert, alles von „herausragendem öffentlichem Interesse“. Folglich lautet die Vorschrift, dass nichts davon das Bundesgebiet verlassen darf. Dahingestellt bleibe dabei einerseits, inwieweit im Ausland überhaupt Interesse an den Relikten und Reliquien besteht. Mit Kultur haben, andererseits, der Fußball und damit seine Protagonisten auf dem Spielfeld und an dessen Rand allemal zu tun, darauf sollten wir Feuilletonisten gerade heute, am Starttag der Europameisterschaft im eigenen Land, solidarisch hinweisen. Denn unzweifelhaft schafft dieser Sport Gemeinschaftsgefühle und Identität, und das nicht nur in den Fankurven der Hooligans und Ultras. Auch schrieb er sich unauslöschlich in die Geschichte des für unsere Heimat so wichtigen Vereinswesens ein und hinterließ mit dem „Wunder von Bern“ vor siebzig Jahren ein flammendes Erinnerungsmal im kollektiven Gedächtnis. Und putzen Ausstellungen und Performances, Kino und Konzerte nicht immer wieder die Rahmenprogramme vieler Großveranstaltungen des Fußballs auf? Literarisch gingen und gehen ihm Schriftsteller wie Ror Wolf auf den Grund; zum Beispiel stand just während der laufenden Saison Patrick Marbers Ab- und Aufsteigerdrama „Der rote Löwe“ auf dem Spielplan des Theaters Hof. Unter die Autoren ging 2021 auch der französische Spieler Paul Lasne, als er Corona-halber ein wenig freie Zeit fand („MurMures“, etwa „Lockdown-Geflüster“), und konstatierte: „Fußball ist eine Kunst.“ Wirklich lässt sich die Sportart durchaus mit den idealistischen Parametern des Wahren, Guten, Schönen beschreiben. Unverhüllt erweist sich auf dem Platz, was einer kann und was nicht, und jeder wird geahndet. Durch spieltechnisches Vermögen, Persönlichkeit und Leidenschaftlichkeit offenbart sich die Güteklasse der Kickerinnen und Kicker. Und selbst die Ästhetik spricht ein Wort mit: Als vor fünf Wochen der einstige argentinische Weltmeistertrainer Cesar Luis Menotti 85-jährig gestorben war, wurde ihm vielfach nachgerufen, er habe einen besonders „schönen Fußball“ verfochten. Dasselbe tun (mehr noch als die Spielerfrauen) die spielenden Frauen, seit sie zunehmend Erfolge feiern - „Warum Frauen schöner Fußball spielen“, versuchte die Süddeutsche Zeitung schon 2015 zu ermitteln. Zwar bestand Sepp „der Chef“ darauf, ausschließlich Männer zu trainieren, doch sogar für Bildung als eines der zentralen Kulturgüter steht seine unvergessene Person, beherbergte Herbergers Haus in Hohensachsen doch eine umfangreiche Bibliothek: Mao, Machiavelli, Clausewitz … Dem Deutschlandfunk berichtete Manuel Neukirchner, Gründungsdirektor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, der Trainer habe Gäste gern und stolz zu seinen Büchern geführt. Zu Recht: Denn sind sie wahr, sind sie gut. Und sind sie gut, sind sie auch schön. ■
Zwanzig Tage
11. Mai Als schlimmstes Unglück, das Eltern widerfahren mag, gilt den meisten von uns das Verschwinden eines Kindes. Sein Tod kann Väter, Mütter, Partnerschaften zerstören. Womöglich aber ist, so dürfen wir vermuten, die Qual noch größer, geht das Kind als Vermisstenfall verloren. Seit dem 22. April fehlt einer Familie in Bremervörde ihr kleiner Sohn: Spurlos verschwand der sechsjährige Arian, und auch ein 1200-köpfiges Heer von Polizeibeamten, -beamtinnen und Freiwilligen fand ihn bislang nicht. Nur ein ‚Fall‘ von 1845 Mädchen und Jungen unter dreizehn Jahren, von denen zurzeit jedes Lebenszeichen fehlt; insgesamt führt das Bundeskriminalamt 9554 Personen als abgängig, siebzig Prozent davon sind männlich. Erfahrungsgemäß taucht das Gros der Vermissten nach Tagen oder Wochen wieder auf, nur drei Prozent bleiben länger als ein Jahr unauffindbar. Indes lassen uns die notgedrungen unempathischen Medienmeldungen und Statistiken kaum je ahnen, dass zu einem verschwundenen Menschen stets verlassene Menschen gehören, Angehörige, in Angst zurückgeblieben. Von einem Augenblick zum nächsten entbehren sie einen wichtigen Teil ihres Daseins, ein Objekt ihrer Liebe, fortan zerrissen zwischen Hoffnungen und Ungewissheit. Mögen auch den allermeisten von uns derlei Prüfungen zum Glück erspart bleiben, so sollten wir doch für ein paar mitmenschliche Momente innehalten, um uns ihre Lage zumindest annähernd klarzumachen. Brannte Arian durch und verlief sich dann? Was erleidet er in gerade dieser und der nächsten Stunde? Fiel er einem Verbrechen zum Opfer? Warum er? Durch Zufall? Oder wählte und spähte ihn jemand vorsätzlich aus? Im Dasein der betroffenen Familie dürfte wohl jede Normalität und Routine ihre Bedeutung schlagartig verlieren. Monoman zermartern sich die Gehirne beim Grübeln nach Gründen, zugleich wird das vermeintlich umfriedete Heim zum schutzlos offenen Ort unauflöslicher Widersprüche: Das Kind fehlt und bleibt doch anwesend in jedem Spielzeug und Kleidungsstück, das bis vor Kurzem sein eigenwertig unverwechselbares Leben charakterisierte und nun seine selbstverständliche Gegenwärtigkeit nur noch vortäuscht. Wie wohl hält sich das Bild des Vermissten in der Erinnerung, die, wie wir alle wissen, schon nach ein paar Tagen zu Verklärungen oder Verzerrungen neigt: Drückten die letzten Worte und Blicke mit ihm Zugewandtheit und Zuneigung aus, oder herrschte Druck, Spannung, Streit? In einer Gesellschaft wie der unseren, die auf allgemeine Sicherheit als einen ihrer höchsten Zwecke setzt, entzieht das unergründlich plötzliche Fehlen eines Menschen seinen Nächsten unweigerlich den Boden unter den Füßen – das unterscheidet einen solchen Verlust von der schmerzhaften Lücke, die ein absehbarer Todesfall in unsere Kreise reißt. Alle fünf bis zehn Jahre verdoppelt sich das Wissen der Welt, doch das vitale Interesse von uns Individuen stößt in einer Ausnahmesituation bereits nach drei Wochen an undurchdringliche Grenzen. Zwanzig Tage - schon so lange scheint der kleine Adrian wie ausgelöscht; seinen Tod allmählich für gewiss zu halten – heißt das, ihn vorschnell abzuschreiben? Am 30. April stellte die Polizei die „aktive Suche“ nach ihm ein; seither gehe, heißt es, eine Ermittlungsgruppe „ganz vielen Hinweisen“ nach. Inzwischen baten die Eltern eine ehrenamtliche Suchhunde-Staffel um Hilfe, auch dies ein Gradmesser ihres Grams. ■
Wie Wagners wohnen
2. Mai Manchen Leuten können ihre Häuser nicht groß genug sein; andere hingegen fliehen aus den Weiten eines überdimensionierten Domizils. Ludwig II., zum Beispiel, der royale Jünger und Mäzen Richard Wagners, ließ um seine allerhöchste Person herum kolossale Schlösser bauen, in denen er am liebsten allein blieb, nur mit sich. Dagegen schätzt Katharina Wagner zu viel Leere offensichtlich nicht: Bis vor Kurzem noch residierte sie im stolzen, streng gegen Zugang und neugierige Einsichtnahme abgeschirmten Eigenheim schräg gegenüber des von ihr geleiteten Bayreuther Festspielhauses; das Anwesen hatte ihr Vater Wolfgang in den Fünfzigerjahren erworben: 700 Quadratmeter Wohnfläche, genug für mehrere Familien, zu viel für eine Dame allein. Darum hat sies jetzt verkauft. Irgendwo zwischen König und Katharina hielt sich ihr Urgroßvater Richard Wagner selber auf: Das Wohnhaus des bekanntermaßen nicht eben bescheidenen Dichterkomponisten und Festspielgründers im Hofgarten enthält auf einer Grundfläche von knapp 360 Quadratmetern neben dem Erd- und einem Obergeschoss noch einen Keller und einen Zwischenstock. „Ich habe viele Jahre meines Lebens dem wüsten Walten des Zufalls anheimgeben müssen, nenne keinen Besitz mein und lebe wie ein Flüchtling in der Welt“, schrieb Wagner 1871 an den bayerischen Regenten. „Für den so wichtig gewordenen Rest meines Lebens muss ich dort leben, wo ich mir einen angemessenen Wirkungskreis bereitet wissen kann: Dies muss im Herzen Deutschlands sein, und glücklich bin ich, diesen jetzt auserwählten Punkt in Ihrem Königreiche inbegriffen gefunden zu haben.“ Tatsächlich finanzierte der Monarch die Baukosten der Villa maßgeblich mit, in der des Meisters „Wähnen“ 1874 endlich „Frieden fand“. Wahnfried nannte er den wuchtigen Sandsteinbau, der ihm bis in sein Todesjahr 1883 üppig Obdach bot. Hier vollendete er mit der „Götterdämmerung“ den singulären Opernzyklus des Nibelungen-„Rings“ und trieb sodann die Arbeit am letzten Werk, dem „Parsifal“, voran. Aus heutiger Sicht nicht eben ein lauschiger Unterschlupf für eine kleine Familie; seinerzeit indes war dergleichen durchaus üblich in den groß- und bildungsbürgerlichen Kreisen, denen der Kleinbürgerspross und steckbrieflich gesuchte Dresdner Revolutionär von ehedem unbedingt zugehören wollte. In den Heimstätten jener Oberschicht galt es nicht nur zu schlafen, zu essen und sich zu erholen; mit sichtbarer, womöglich einschüchternder oder gar Neid erweckender Erlesenheit herausgeputzt, dienten sie ebenso als Bühnenbild kalkulierter Selbstdarstellung, deren Staffage geltenden Maßstäben mindestens zu genügen, wenn nicht sie zu übertreffen hatte. So erhob sich in Wahnfried die Halle des Erdgeschosses über dem – mit 1,66 Metern nicht eben hünenhaft gewachsenen – Tonsetzer sechzehn Meter hoch, und den Saal mit dem bis heute original erhaltenen Steinwayflügel umringten die gediegen gefertigten 2500 Einbände seiner Bibliothek. Seit 1976 beherbergen Wahnfried und die Nebengebäude das bedeutsame Richard-Wagner-Museum. Katharina ist, wie sie mitteilte, in ein Loft mit Dachterrasse im Stadtzentrum gezogen. Der „so wichtig gewordene“ Meister fand seine letzte, längste Bleibe im Garten seiner Villa, unter einem efeuüberwucherten Hügel mit schlichter Platte, gleich beim Grab des Lieblingshundes Russ. Irgendwie unwagnersch: vergleichsweise bescheiden. ■
Geben statt nehmen
20. April Seit es einen Kunstmarkt gibt, wird mit Kunst gehandelt, die keine genannt werden darf. Als Täter gehen einerseits Ganoven zu Werke, die über hohes Können verfügen mögen, aber der inspirierenden Kreativität entbehren, sodass sie es mit ihren Erzeugnissen bei bloßer Nachmacherei von Vorgegebenem bewenden lassen müssen. Andererseits machen sich nicht minder versierte Handwerker an die Arbeit, die zusätzlich über genug Eingebung verfügen, um Persönliches hervorzubringen, nur eben im Stil von Zelebritäten. Größte Prominenz in jener Gruppe erarbeitete sich Wolfgang Fischer, der es unterm Künstlernamen Wolfgang Beltracchi zum „Jahrhundertfälscher“ brachte: Bis er 2010 aufflog, imitierte er gewinnbringend alle möglichen Sujets so meisterlich in der Malweise etwa von Max Ernst, Max Pechstein oder Heinrich Campendonk, dass auch ausgebuffte Kenner auf die Falsifikate hereinfielen; inzwischen bietet Beltracchi seine Produkte als Marke feil. Nicht als Fälscher, sondern als selbstbewusster Maler aus persönlicher Kraft wollte sich vor einigen Wochen ein Techniker der Pinakothek der Moderne in München bewähren, indem er Joseph Beuys’ Devise, der zufolge „jeder Mensch ein Künstler“ ist, konsequent auf sich anwandte: An einer Wand der weltbekannten Sammlung brachte er mitten unter auserlesenen Exponaten ein Gemälde aus seinem Liebhaberatelier an. Das Gegenteil eines Plagiats: Der Mann produzierte und präsentierte explizit Eigenes; erst recht das Gegenteil eines Diebstahls: Er nahm ja nichts fort, sondern fügte sogar etwas hinzu; nicht einmal für Betrug muss mans halten: Zumindest materiellen Nutzen zog er nicht daraus. Da mögen sich weniger verwegene Mitmenschen an ihre Jugend erinnert fühlen, als juvenile Talentproben in Kunstsaal, oder Treppenhaus, Aula oder Pausenraum ihrer Schulen aufgehängt wurden. Wer sich in der Kriminalgeschichte der Kunst auskennt, verweist lieber auf Koryphäen wie den arrivierten Maler Han van Meegeren aus den Niederlanden, der sich in den 1930er- und 1940er-Jahren die Manier Jan Vermeers derart täuschend anverwandelte, dass sich Adolf Hitlers „Reichsmarschall“ Hermann Göring gierig seine unter falscher Flagge segelnde Leinwand „Christus und die Ehebrecherin“ sicherte. Aus den USA wurde unlängst ein ähnlicher und doch besonderer Fall vermeldet: Dort verurteilte ein Gericht einen 61-Jährigen zu 52 Monate Haft; er hatte gestanden, gemeinsam mit seiner Frau nicht nur falsche Holzschnitte aus dem fünfzehnten bis zwanzigsten Jahrhundert verkauft zu haben, sondern desgleichen selbst hergestellte Druckstöcke vorgeblich für Grafiken aus der deutschen Reformationszeit, also die großen Holzstempel, von deren eingefärbter Oberfläche seiner Behauptung zufolge die Blätter abgezogen wurden. Schwunghaft vertrieb er via Internet Hunderte solcher Nachbildungen; in Wirklichkeit kommen authentische Druckstöcke kaum je in den Handel. Recht kleinkariert reagierte die Leitung der Pinakothek auf den vergleichsweise harmlosen Durchbruchversuch ihres Mitarbeiters: Nicht nur, dass sie ihn feuerte; obendrein zeigte sie ihn wegen Sachbeschädigung an – hatte er doch zur Befestigung seines Werks Löcher in die Wand gebohrt. Nun findet der Sonntagsmaler reichlich Zeit, sich weiter zu vervollkommnen. Nach einem Ausstellungsraum, dessen Rang und Ruf mit dem des berühmten Münchner Kunstareals mithält, wird er indes wohl eine Weile suchen müssen. ■
Theorie des Streichelns
19. März Die Wenigsten von uns, und schon gar nicht die Dünnhäutigen, mögen bei jeder unpassenden Gelegenheit gleich mit einem Schlag auf die Schulter begrüßt werden. Bei taktlos hemdsärmeligen Willkommensgesten geht so mancher weiche Zeitgenosse in die Knie, aus den zarten Saiten der Mimosen unter uns schallen überlauten Rabauken Misstöne entgegen, und selbst weniger Hochsensible verschließen sich misstrauisch oder übellaunig vor allzu ungehemmter Nonchalance. Obendrein machen es uns die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und der Mee-too-Bewegung nicht eben leichter, einander unvoreingenommen anzufassen. Tatsächlich empfiehlt sich dabei Vorsicht, wenn wir bedenken, wie breit das Spektrum möglicher Berührungen ist. Zwar gehen sie in der Mehrzahl von einem Körperkontakt mit den Händen aus – dabei aber können wir einander versehentlich streifen oder schützend ergreifen, aufweckend antippen oder prüfend abtasten, schüchtern befummeln, vertraulich umarmen oder impulsiv umklammern, warnend anpacken oder grob von uns stoßen. Nicht selten, zum Glück, ereignet es sich auch, dass wir einander streicheln – Zeichen der Anteilnahme, Austausch von Herzenswärme. Doch gerade hierbei sind Behutsamkeit und also im Voraus ein paar theoretische Erwägungen angebracht. Befragen wir gängige gedruckte und digitale Wörterbücher nach Wesen und Bestimmung von etwas so Begehrtem, Angenehmem und Willkommenem wie der Streicheleinheit, so zeigen sie sich einig darin, dass es sich dabei um ein „gewisses Maß an freundlicher Zuwendung in Form von Lob, Zärtlichkeit oder Ähnlichem“ handle, wobei uns in aller gebotenen Nüchternheit zweierlei auffallen muss: Zum einen setzt die Streicheleinheit zwar Sympathie, aber keineswegs gleich Liebe voraus; und zum andern darf sie das besagte „gewisse Maß“ nicht überschreiten, sollte also unbedingt in einer Dosierung abgegeben werden, die weder die spendende noch die empfangende Person kompromittiert oder gar verletzt. Dass sich Letzteres ereignet – und in existenzbedrohendem Maß –, musste unlängst die prominenteste Liebende Italiens und der Weltliteratur erleiden: In Verona, im Hof des Anwesens Via Capello Nr. 23, begrapschten die Touristen in ihren endlosen Strömen den unschuldigen Busen der jugendlichen Julia millionenfach so unbarmherzig, dass seine mehr und mehr ausgedünnte Oberfläche jetzt nachgab und sich in einem Loch öffnete. Das will was heißen: Immerhin besteht die Haut des Mädchens aus Bronze; einem rücksichtsvollen Romeo wäre, im realen Leben, ein ähnliches Missgeschick noch in Momenten höchster Brünstigkeit wohl kaum passiert. Eine ähnliche Verstümmelung lässt der heilige Petrus, in Gestalt seines nicht minder vielbesuchten Standbilds im Petersdom zu Rom, mit märtyrerhafter Langmut über sich ergehen: Besucher des Gotteshauses haben mit ihren Händen den rechten Fuß des Apostels nicht bloß messinggelb blank gescheuert, sondern durch beständigen Abrieb zu einer Art flacher Flosse verfälscht. Derlei Körperschäden an so populären Abbildern unserer Physis warnen uns ernstlich: Wenn schon ein solider Panzer wie sorgsam gegossenes Metall unseren Zudringlichkeiten nicht standhält – wie viel mehr Schonung beansprucht dann die widerstandsfähige, freilich nicht reißfeste Schutzhülle von uns selbst? Bei dünner Haut hilft nur, was keiner Bronzestatue gegeben ist: ein dickes Fell. ■
Kriminell kreativ
25. Februar Im Fall der Künste entfällt nicht alle kriminelle Energie auf jene bösen Menschen, die Kunst rauben, fälschen oder gar zerstören. Auch unter den Kreativen selbst, und in allen Gattungen, findet sich so mancher schlimme Finger. Wie im berühmten Kurzkrimi „Das Fräulein von Scuderi“ von 1819: Darin erzählt E.T.A. Hoffmann vom Ende des Goldschmieds René Cardillac, der ums Jahr 1680 so besessen an dem von ihm geschaffenen, exquisiten Geschmeide hängt, dass er die Käufer ermordet, um es ihnen raubend wieder wegzunehmen. Als „Cardillac-Syndrom“ bezeichnet die Psychologie denn auch das gar nicht seltene Phänomen, dass ein Künstler oder eine Künstlerin sich von Werken partout nicht trennen mag; zum Beispiel bedingt sich der Österreicher Arnulf Rainer beim Verkauf seiner Gemälde das Recht aus, sie jederzeit aufzusuchen und sogar zu verändern. Als realer Vorgänger Cardillacs machte Benvenuto Cellini im sechzehnten Jahrhundert die Straßen Italiens unsicher. In seiner (von Johann Wolfgang von Goethe übersetzten) Autobiografie nimmt Cellini – Schöpfer des kostbarsten Salzgefäßes der Welt und des lässigen Bronze-Perseus in der Florentiner Loggia dei Lanzi – nicht weniger als drei Morde für sich in Anspruch. Als Vergeltungsakt beging er 1529 den ersten, indem er den Mann erstach, der zuvor seinen Bruder getötet hatte. Offenbar nur wenig reuig, weil nicht ohne Genugtuung schildert der Rächer in seinen Memoiren, wie er dem Opfer den Dolch mit solcher Wucht in den Nacken rammte, dass er ihn nicht mehr herausbekam. Desungeachtet würdigt die Kunstwissenschaft Cellinis schöpferische Genialität. Einem arg vollmundigen Diktum von Joseph Beuys scheint sie recht zu geben, der Künstler und Verbrecher zu „Weggefährten“ erklärte: „Beide sind ohne Moral und verfügen über eine verrückte Kreativität, nur getrieben von der Kraft der Freiheit.“ Eine schwer haltbare Auffassung; gleichwohl könnte als ein Beleg unter den Autoren der Franzose Jean Genet herhalten, der wegen Diebstahls und Betrügereien immer wieder hinter Gittern saß, verherrlicht er doch in seinem Werk hartnäckig Verbrechen, Gewalt und Anarchie. So gab er die weitaus anstößigere Figur ab als der vergleichsweise harmlose Fabulierer Karl May, der ähnlicher Delikte halber alles in allem sieben Jahre in Haft verbrachte. Schwerwiegender in der Nähe zum Kapitalverbrechen verortetete sich hingegen Genets Landsmann Paul Verlaine, durch zwei Pistolenschüsse: In mehr oder weniger mörderischer Absicht, jedenfalls verzweifelt feuerte der Lyriker sie 1873 auf seinen zehn Jahre jüngeren Geliebten und Poetenfreund Arthur Rimbaud ab, als der sich von ihm trennen wollte. Unter den Musikern gebührt der finstere Rang des namhaftesten Killers dem Komponisten und Lautenisten Carlo Gesualdo, Fürst von Venosa: Als er am 17. Oktober 1590 seine Frau Maria d’Avalos mit einem gräflichen Galan beim Liebesspiel ertappte, war beider Leben verwirkt; schaurig wurden sie niedergemetzelt, vermutlich von des Fürsten eigener Hand. Wie stark die Bluttat Gesualdo lebenslang bedrückte, erhellt aus den brutalen Auspeitschungen, denen er sich zur Sühne fortan unterzog, und, bis heute staunend greifbar, aus der an schmerzlichen Dissonanzen reichen, mit ihrer chromatischen Harmonik schier modernen Tonsprache seiner grandiosen Madrigale. Umso entspannter stand Paul Hindemith - der nach E.T.A. Hoffmanns Novelle die 1926 uraufgeführte Oper "Cardillac" schuf - als 26-jähriger Bühnen-Anfänger der Tötung in Tönen gegenüber: Sein erstes Musikdrama heißt optimistisch „Mörder, Hoffnung der Frauen“. ■
Mythos Mauer
20. Februar „Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die Fahnen“: So trostlos malte Friedrich Hölderlin 1803 im bekanntesten seiner „Nachtgesänge“ das Bild seines Daseins. Ebenso hätte der Dichter damit den vierzigsten Geburtstag der DDR, ihren letzten, 1989, gemeint haben können. Kein anderes Land lud den Begriff und das Bild der Mauer als eines dialektischen Bauwerks derart mit sprachlos machenden, eiskalten Gedankenverbindungen auf. Dabei gibt sie zunächst ein im Grunde positives Sinnbild ab für etwas fest Gefügtes, mithin Bergendes und Schützendes, für die „Umfriedung“ eines Platzes, für Sitz und Besitz, für den Übergang vom Äußeren ins Eigene. Wer wohl, und wozu, schichtete vor geschätzten zehntausend Jahren auf einem Landstück im Nordwesten des heutigen Ostseebads Rerik jene Steine, über die seit 8500 Jahren das Meer flutet, heute 21 Meter hoch? In der vergangenen Woche berichteten Medien über den Fund, der Forschenden des Leibniz-Instituts in Warnemünde und der Universität Rostock gelang. Die den Wall errichteten, mussten gute Gründe haben, denn große Mühen wandten sie auf, um 1673 Felsbrocken zu einer ein Meter hohen, zwei Meter breiten und fast einen Kilometer langen Schanze zu fügen. Wen oder was suchten sie von sich fernzuhalten? Oder handelt es sich bei der steinzeitlichen Anlage – eine der größten ihrer Art aus jener Epoche in Europa – gar nicht um eine defensive Befestigung? Tatsächlich halten die Forschenden es für möglich, dass sie der Jagd auf Rentiere gedient habe. Solch friedlicher Absicht dienen Mauern freilich weitaus seltener als fortifikatorischen Zwecken, an die sich obendrein oft noch ideologische binden. So adelten die Herren Ulbricht und Honecker die Grenzwand, die von 1961 an Berlin auf einer Länge von 155 Kilometern 28 Jahre lang einschloss, zum „antifaschistischen Schutzwall“, obwohl sie ihre Bestimmung doch darin fand, zusammen mit den übrigen ostdeutschen Sperranlagen ein riesiges Gefängnis einzurichten. Aber Mauern fallen; und mitunter gewinnt solch ein Ereignis mythische Züge. Das war schon so bei der ältesten Stadt der Welt: Archäologen wissen, dass in Jericho vor zehntausend Jahren die Bewohner zwar noch keine Töpferwaren kannten, ihre Siedlung aber bereits wehrwirksam mit steinernen Bollwerken und Türmen zu umgeben verstanden. Im alttestamentarischen Buch Josua berichtet die Bibel, wie die Israeliten vor etwa 3400 Jahren die bronzezeitliche Metropole ein ums andere Mal umkreisten, am siebten Tag gar siebenfach; der Klang von sieben Posaunen, die sie dabei geblasen hätten, habe die Basteien in Trümmer zerfallen lassen. Zwar bereitete der verbarrikadierten DDR nicht Blechblasmusik das Ende, wohl aber, auch ihr, marschierendes, demonstrierendes Fußvolk. So wuchs das Mauerblümchen des Freiheitswillens, von der Partei stets als Unkraut bekämpft, schließlich zum grünenden Steinbrech sich aus. Übrigens wissen Globetrotter ebenso wie Sportfreunde manche Mauer zu schätzen: Als mit Abstand berühmtestes und staunenswertestes Exemplar muss die Chinesische Mauer gelten, ein vielteiliger Komplex zur Verteidigung gegen Reiternomaden aus der Mongolei und Mandschurei, zwischen dem achten vorchristlichen und dem siebzehnten nachchristlichen Jahrhundert nach und nach aufgeführt durch Millionen von Menschen. Deutlich niedriger liegt der Personalbedarf für die Mauer, die sich beim Fußball aus Leibern formiert, um vor dem Tor Schlimmes zu verhüten. ■
Teure Ware
10. Februar So schön wie richtig alte Bücher selbst kommen uns die exotischen Begriffe vor, die sich mit ihnen verbinden: Inkunabel … Illumination … Pergament ... Letzteres bezeichnet einen Schriftträger aus Tierhaut; Enthaarung, Glättung und Beschnitt machen sie seit mindestens 2100 Jahren geeignet, als so erlesenes wie dauerhaftes Medium Mitteilungen von besonderer Bedeutung aufzunehmen. Unter Illuminationen haben wir die Buchmalereien zu verstehen, die im Mittelalter den Worten vielfach beigegeben wurden – wörtlich aus dem Lateinischen verdolmetscht ‚Ins-Licht-Setzungen‘, weil ihr farbiges Hell-Dunkel uns den verbalen Inhalt anschaulich macht. Inkunabeln, vom lateinischen cunae für Wiege, heißen die „Wiegendrucke“, die während der ersten Jahrzehnte der „Schwarzen Kunst“ mit beweglichen Lettern bis zum Jahr 1500 entstanden. Um einen solchen Frühdruck handelt es sich beim „Missale von Evreux“ zwar nicht, denn aus dem Jahr 1527 hat es sich überliefert; aber aus Blättern kostbaren Pergaments besteht das liturgische Buch, und die mehr als 150 Holzschnitte mit Szenen unter anderem aus dem Leben Jesu präsentieren sich sorgsamst illuminiert, also farbig ausgestaltet. Auch in Zeiten, da Bücher ohnehin als Luxusgut gehandelt wurden, konnten sich solche Prachtausgaben nur die Steinreichsten leisten. In Paris fertigte ein unbekannter Künstler das Missale für die prominente Hofdame, Dichterin und Sammlerin Anne de Graville an. Jetzt wurde das bald 500jährige Prunkwerk in Stuttgart für stolze 680.000 Euro feilgeboten, als teuerstes Angebot der Antiquariatsmesse vom vorvergangenen Wochenende. Für das teuerste Buch überhaupt dürfen wir das Exemplar freilich nicht halten. Auch muss, um einen exzeptionellen Preis zu erzielen, ein Buch kein Halbjahrtausend alt sein. „Die Märchen von Beedle dem Barden“ aus Joanne K. Rowlings siebtem und letztem „Harry Potter“-Abenteuer wechselten, von der Autorin 2007 eigenhändig niedergeschrieben, zudem eingefasst in einen Ledereinband mit silbernem Dekor, bei einer Sotheby's-Auktion für 2,75 Millionen Euro den Besitzer; ein Rekord: hatte doch nie zuvor ein Manuskript einer lebenden Person eine solche Summe erzielt. Für etwa elf Millionen Euro erwarb 2012 die British Library in London das älteste erhaltene Buch Europas, das im achten Jahrhundert kopierte, Taschenbuch-große Johannes-„Evangelium des St. Cuthbert“. Natürlich stehen auf der Rangliste auch die Inkunabeln der bis 1454 teils auf Papier, teils auf Pergament gedruckten Gutenberg-Bibel. Die Spitze aber hielt bis 1994 das reich illuminierte „Evangelium Heinrichs des Löwen“ aus dem zwölften Jahrhundert; das wollte sich der Bankmanager Hermann Josef Abs 1983 zulegen, allerdings schnappten Bund, Länder und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz es ihm für 32,5 Millionen Mark weg. Schließlich schlug Bill Gates zu: Dem Microsoft-Multimilliardär war der „Codex Leicester“ von der Hand Leonardos da Vinci 30,8 Millionen Dollar wert; auf 72 Seiten enthält die Kladde naturwissenschaftliche Notate und Skizzen des Genies, nicht zwar auf Pergament und nicht illuminiert, doch in Text und Darstellung von minuziöser Akribie. Indes brauchen geborene Lesende keine Millionen für schrankenlose Erfüllung auszugeben, denn die kann ihnen schon ein lädiertes Paperback aus dem Wühlkorb eines Kaufhauses bescheren. Teurer als das meiste sonst sollte uns die Fähigkeit zu lesen sein – ein Privileg und unbezahlbar. ■
Abgrund und Gipfel
23. Januar Brüssel ist für mehr als einen Superlativ gut. So manchem Globetrotter gilt der Grote Markt als schönster Platz der Welt. Mit dem 102 Meter hohen Atomium besitzt es seit 1958 das größte Atommodell auf Erden, einen kolossalen dreidimensionalen Bauplan von der kristallinen Elementarzelle des Eisens in 165milliardenfacher Vergrößerung. Fans von Bildgeschichten schätzen die Stadt als Metropole der Comicwelt. Und mit dem „Nemo 33“ besitzt sie eines der tiefsten Indoor-Schwimmbäder des Planeten: Ein rundes Becken führt die Mutigsten der Mutigen fast 35 Meter tief in einen schwarzen Abgrund. Dort findet seit wenigen Tagen (und bis zum 31. März) eine Ausstellung statt, die Schnorchlern, Flaschen- und Apnoetauchern Einblicke in aktuelle Publikationen aus dem Graphic novel-Genre gewährt: Gleich unterm Wasserspiegel ebenso wie in immer lichtloserer Tiefe präsentieren sich die bunten Exponate an den Beckenwänden ordentlich horizontal und vertikal aufgereiht. Mit Recht darf man die Schau, ihres außergewöhnlichen Schauplatzes halber, für eine kleine Sensation halten. Einzigartigkeit indes lässt sich ihr nicht zuschreiben. Denn auch andernorts und anderweitig verfallen waghalsige Zeitgenossinnen und -genossen hier und da auf extreme Orte, um außerhalb von Sammlungen, Museen, Galerien Kunst zu präsentieren. Im und unter Wasser ist hierbei der britische „eco-artist“ Jason de Caires Taylor zu den Pionieren zu zählen: In seinem Underwater Sculpture Park auf dem karibischen Meeresboden vor der Westküste Grenadas verwandeln sich seit 2006 reliefierte Steinplatten und menschliche Zementfiguren, kniend oder liegend oder im Kreis stehend oder als „Verlorener Korrespondent“ an einer Schreibmaschine sitzend, durch Überkrustung allmählich in ein künstliches Riff, das Korallen und damit einer breitgefächerten Fauna eine künstlich-kunstvolle Heimat bietet. Die Zeitschrift National Geographic nahm das Projekt in seine Liste der 25 Weltwunder auf. Mit gar fünfhundert Figuren bevölkerte de Caires Taylor 2009 sein Unterwassermuseum „MUSA“ vor dem mexikanischen Cancun. In die genau entgegengesetzte Richtung drängen andere Spezialisten: nämlich hoch hinauf. Gut 5300 Meter hoch, in einem der Basislager für den Aufstieg zur Spitze des Mount Everest, organisierte der Nepalese Mekh Limbu 2018 eine Gruppenausstellung mit künstlerischen Arbeiten, die der bedrohten Schönheit des Himalaya huldigten. Auf hochgebirgigen Schneeflächen in verschiedenen Teilen des Globus, in den Alpen sowohl wie auf dem Gipfel des Mount Victoria in Neuseeland, spurte und spurt seit heuer zwanzig Jahren der Brite Simon Beck stiefelnd, stapfend, trampelnd geometrische Muster in die weiße Pracht: Etwa zwölf pausenlose Stunden braucht er für eines der vertrackten Gebilde, wobei er jeweils bis zu vierzig Kilometer zurücklegt; so entstehen hektargroße Grafiken von mathematisch kühler, unvermeidlich vergänglicher Schönheit, weil Wind oder Tauwetter sie absehbar wieder auslöschen. Und auch ins Innere von Bergen zieht sich Kunst seit jeher zurück: In den Höhlen etwa von Lascaux und Chauvet in Frankreich oder von Altamira in Spanien haben prähistorische Menschen einzigartig ausdrucksvolle, vollendet naturalistische Darstellungen der sie umgebenden Tierwelt hinterlassen, neun-, vierzehn- oder dreißigtausend Jahre älter als die Comics im Brüsseler Tiefenbecken und den eisigen Schemata eines Simon Beck an Haltbarkeit beträchtlich überlegen. ■
Über uns
20. Dezember Zwei Dinge, so bekannte Immanuel Kant am Ende seiner „Kritik der praktischen Vernunft“, ließen ihn vor Bewunderung erschauern: nicht allein das „moralische Gesetz“ in ihm, dem er zuvor ausführlich nachgespürt hatte, sondern mehr noch und zuallererst „der bestirnte Himmel über mir“. Der steht unseren Blicken offen und kommt uns doch wie ein Buch mit sieben Siegeln vor. Wir Erdbewohner können nur fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass es ‚da draußen‘ Schwarze Löcher gibt, die neben jeder Art von Materie auch das Licht aufsaugen und Raum und Zeit zersetzen; oder dass 27 Prozent des Universums mit der unerforschlichen Dunklen Materie gefüllt sind, aber nur mit fünf Prozent der uns vertrauten normalen … Das verstehe, wer mag. Wir haben ja noch nicht einmal den „Stern von Bethlehem“ zweifelsfrei identifiziert, der dem biblischen Evangelisten Matthäus zufolge während und nach der „heiligen Nacht“ den neugeborenen Jesus im Stall bestrahlte: Wars eine Supernova? Ein Komet? Oder die „Konjunktion“ zweier Himmelskörper, die ihr Strahlen vereinten, solange sie sich auf einer Linie mit der Erde aufhielten? Vielleicht Saturn und Jupiter? Oder Jupiter und Regulus, der hellste Stern im Bild des Löwen? Überhaupt: Sternbilder. Wer wohl verfiel vor wie viel tausend Jahren als Erster darauf, beziehungslose Leuchtpunkte am Firmament, deren stellare Quellen womöglich Millionen von Lichtjahren voneinander und von unserer Erde entfernt sind, zur Gestalt eines Schützen oder einer Jungfrau, zu Krebs oder Waage zusammenzufantasieren? Was wir und viele andere Kulturen auf dem schwarzen Malgrund der Nacht an schimmernden Konfigurationen erschauen, verrät wenig Wahres über den Himmel, freilich umso mehr über uns. Weil wir in unserer unentrinnbaren Begrenztheit nichts kennen, das weiter als der Himmel wäre, verklären wir ihn gern zum „siebten Himmel“ der Freiheit, des Glücks und der Erfüllung, wir bestaunen ihn als Schauplatz unantastbar höherer Ordnung und ewiger Wiederkehr, wenn wir nicht gar Gott und sein paradiesisches Jenseits in ihm erhoffen. Wer der Astrologie anhängt, schmeichelt sich unverdient mit der Vorstellung, etwas so Erhabenes wie die Gestirne stünden mit unseren schäbigen Schicksalen magisch in Berührung. Dabei setzt spätestens seit der frühen Neuzeit die wissenschaftliche Astronomie alles daran, unseren Planeten aus dem Zentrum des Weltraums wegzuschieben und wie ein gleichgültiges Staubkorn an den Rand der Galaxis zu entsorgen. Von der Krone der Schöpfung hat die Forschung unsere Spezies zum ziemlich zweifelhaften Zufallsprodukt der biologischen Evolution degradiert. Und doch tragen wir im Kopf ein Universum mit uns herum: Das Gehirn, durch das wir all dies ergründen, ist die komplizierteste Struktur, die unser Wissensdrang im All je aufgespürt hat. Ein zweischneidiges Schwert: Um mit unseren zerebralen Kräften nicht die Hölle auf Erden zu entfesseln, sollten wir uns wohl nach dem Himmel in uns selbst umsehen - und damit am Rand beginnen: an unserm Horizont, den gelegentlich der eine oder andere Blick nach oben, immer aber jeder Erdenschritt nach vorn erweitert. Wie stolz und mutig manche Menschen trotz aller Bodenhaftung das unendlich Ungreifbare in die Hand zu nehmen wagen, das führten uns schon die Schöpfer der Himmelsscheibe von Nebra vor: Bereits vor bald viertausend Jahren gab sie ein Beispiel dafür, dass die Bilder, die wir aus dem „bestirnten Himmel über uns“ und unseren Köpfen herauslesen, stets ein Stück von uns selber wiedergeben. ■
Teufels Küche
7. Dezember Wer mit dem Teufel frühstückt, muss einen langen Löffel haben. Den Antichrist zu attackieren, setzt einen archaischen katholischen Glauben an ihn, gediegene Lateinkenntnisse und reichlich Geduld voraus. Länger noch als der Löffel des Gottseibeiuns ist die Tradition des Exorzismus, die zweitausend Jahre zurückreicht. Jene ritualisierte Austreibung dämonischer Mächte nehmen Priester bei der Taufe vor, freilich so beiläufig, dass mans kaum merkt. Irritierend ins Auge fällt erst eigentlich der „Große Exorzismus“ an Menschen, denen unterstellt wird, von Beelzebub oder seinen Unholden besessen zu sein. Solche Höllenkreaturen beschwören und bannen zu wollen, und zwar auf Teufel komm raus, könnte man freisinnig für Überbleibsel eines vorzivilisatorischen Schamanismus halten – triebe nicht nach wie vor eine päpstlich sanktionierte „Internationale Vereinigung der Exorzisten“ ungehemmt ihr Wesen. Kürzlich trat sie in Sacrofane bei Rom zusammen, wo sie Karel Orlita zu ihrem neuen Präsidenten wählte. Nun steht der tschechisch Priester etwa neunhundert nach vatikanischen Vorschriften praktizierenden Austreibern und ihren Assistenten vor. Wie sie die Prozedur durchzuführen haben, fasste der Heilige Stuhl erstmals 1614 im „Rituale Romanum“ zusammen, das die einschlägigen Evangeliumsverse und Psalmen, Litaneien und Segnungen sowie die symbolischen Handlungen vom Weihwasser-Sprengen über die Handauflegung bis zum Kreuzschlagen aufführt; 1999 modernisiert, lässt der Leitfaden nun auch Erkenntnissen der Medizin und Psychiatrie gelten. Heilige Maßregeln gegen den Leibhaftigen – eine Wohltat für den heimgesuchten Menschen? Ganz so grausig wie in William Friedkins Kinoschocker „Der Exorzist“ von 1973 geht es dabei wohl kaum zu. Wie weit sich gleichwohl der Aberglaube oder Glaube an die Wirksamkeit der okkulten Bräuche bis zur Wirklichkeit vorwagt, zeigt nicht nur der Fall der 23-jährigen, von epileptischen Anfällen und einer Psychose geplagten Anneliese Michel, die auf Geheiß vermeintlicher Stimmen in ihrem Kopf jede Nahrung verweigerte und auf 31 Kilogramm abmagerte, bis sie 1976 in Klingenberg bei Aschaffenburg an Auszehrung starb – nachdem nicht weniger als 67 „Große Exorzismen“ der angeblich bösen Geister in ihr hatten Herr werden sollen. Auch in der Gegenwart kann sich Ähnliches ereignen: Derzeit stehen in Italien 483 Priester, von ihren Bischöfen eigens dazu bestellt, für den speziellen „Heilungs- und Befreiungsdienst“ bereit, in den Vereinigten Staaten 62, in Mexiko 48 … Allein Pater Gabriele Amorth, der ihre Weltvereinigung 1990 gründete und ihr bis zu seinem Tod 2016 vorstand, will in Zehntausenden von Fällen aktiv geworden sein. Sollte eine Kirche, die an derart atavistischen Praktiken festhält, von allen guten Geistern verlassen sein? Verstört von zunehmend irrationalen Diskursen auf allen Gebieten, kommt heutzutage auch der leicht in Teufels Küche, der gegen solcherart Auswüchse einer heillosen Religiosität Gründe der aufgeklärten Vernunft anzuführen wagt. Nicht etwa die bedauernswerten Patienten der Bezirkskliniken haben den Teufel im Leib, sondern diabolische Gewaltherrscher, infernale Falken und un-heilige Krieger, die dafür sorgen, dass in der Welt gerade mal wieder der Teufel los ist. Ob solche Kräfte, die „stets das Böse wollen“, dadurch letztlich „das Gute schaffen“, wie Goethes Mephisto es für sich in Anspruch nimmt? Weiß der Teufel. ■
Bergwunder
2. Dezember Während der vergangenen Sommer der Dürre haben wir auch hierzulande in so manchem See den Wasserspiegel sichtbar sinken sehen; in den Weltmeeren indes lässt der Klimawandel – wie heute jeder von uns, ders wissen will, weiß – die Pegel bedrohlich steigen, des zerrinnenden Polareises wegen. Kaum ist hingegen bekannt, dass solch Auf und Ab auch die Gebirge betrifft. Atmen die Berge? Fast könnten wirs meinen, heben und senken sich doch die Erdkruste und mit ihr die kleineren wie die ganz großen Gipfel wie ein lebendiger Brustkorb, auch wenn nur Geologen es wahrnehmen. So musste es sich Europas höchster Berg gefallen lassen, während der vergangenen zwei Jahre um zwei Meter auf 4805 Meter zu schrumpfen – weil die Erderwärmung einen Teil des bei der Höhenmessung mitgerechneten Gipfelschnees und -eises abschmolz. Andererseits legte der Mount Everest, bekanntlich die höchste Erhebung auf Erden, in den wissenschaftlichen Aufzeichnungen um einen Meter zu. Nicht viel scheint uns das, wenn wir seine aktuelle Höhe von unfasslichen 8849 Metern bedenken, die China und Nepal nach einer gemeinsamen, vor Kurzem veröffentlichten Untersuchung ermittelten. Weil der Koloss an der druckvollen Nahtstelle zwischen der indischen und der eurasischen Kontinentalplatte aufragt, wird er alljährlich um etliche Millimeter nach oben geschoben. Ob ein paar Handspannen mehr oder weniger – auf der schieren Höhe gründet die mythische Gewalt nicht, mit der Berge, eine gewisse Stattlichkeit vorausgesetzt, uns überwältigen können. Zwar lassen wir uns darüber belehren, dass auch die wuchtigsten Massive, wie alles auf Erden, dem Zerfall preisgegeben sind und unter den Wirkkräften der Natur erodieren wie der belangloseste Erdhügel. Dennoch bestaunen wir sie für ihre vermeintliche Unantastbarkeit und das ewige Beharrungsvermögen, das wir ihnen gern zuschreiben. Ungerührt verschließt sich der Berg durch seine Stein- und Steilwände vor uns, und wenn er uns doch in sich hineinlässt, so verweigert er uns in seinen Höhlen das Licht und schreibt uns den Weg vor. Im Berg dürfen wir märchenhafte Schätze vermuten, Erze, Gold und Edelsteine, aber er fordert uns vielerlei Mühen ab, sie an uns zu bringen. Von uns und unserer beschwerlichen Erde wendet sich sein Gipfel schnöde ab und lieber der unzugänglichen Luftigkeit des Himmels zu. Auf dem Berg Sinai soll Mose die göttlichen Zehn Gebote empfangen haben, die dem Hebräervolk die Freiheit von Willkür und Rechtlosigkeit schenkten. Ähnlich, so glauben die Muslime, habe sich in einer Höhle des Bergs Hira, nordöstlich von Mekka, Allah zum ersten Mal seinem Propheten Mohammed offenbart. Auf dem Olymp, dem mit knapp dreitausend Metern höchsten Gebirgszug Griechenlands, siedelten die Hellenen der Antike ihre Götter an; und von der legendären Gralsburg auf dem Montsalvatsch aus zogen die frommen Gralsritter in die heilsbedürftige Welt. In Bergen – dem Untersberg bei Salzburg, dem Kyffhäuser im Harz – sollen große deutsche Kaiser ihrer Wiederkunft und der Erneuerung der Nation entgegenschlummern. Und auf Thomas Manns „Zauberberg“ vollzieht sich alljährlich das Wunder, dass es im Sommer schneien und im Winter sommerwarm werden kann. Dass Gebirge und Gipfel sich so leicht nicht beeindrucken lassen, ohne erst über sich hinauswachsen zu müssen – vielleicht imponiert und irritiert uns das unbewusst am stärksten. Ein Berg schüttelt sich nicht, nur weil einer zu hart auf ihm auftritt. ■
No sports?
29. November Nicht, dass immer Schweiß in Strömen fließen müsste. Doch hängen wir leicht der Meinung an, Sport sollte seinen Namen nur dann verdienen, wenn er den Einsatz von Körperkräften fordert. Die Zweckfreiheit des Spiels schätzen wir an ihm, räumen aber zugleich ein, dass erst das Ziel, in einem Wettkampf zu siegen, vollends zur Energie-Entfaltung motiviert. Mithin ist Sport keineswegs immer Spaß: Nicht wenige schinden sich un- bis übermenschlich, um ihre Leiber an die Grenzen zu führen und, wenns geht, darüber hinaus. Beträchtlich wirkt der Geist mit: Dass etwa Triumphe im Tennis „zu achtzig Prozent im Kopf“ errungen werden, versichern uns die Champions des „weißen Sports“. Uns durchschnittlich Ambitionierten schien hingegen physische Bewegung im Raum Hauptmerkmal und -sache jedes Sports zu sein. Doch denken wir da wohl zu kurz. Bei der ISPO, der weltweit größten Branchenschau, die am Dienstag in München für drei Tage ihre Tore öffnete, nehmen einen unübersehbaren Platz auch die „eSports“ ein: Computerspiele, vor Publikum von Gamern wettkampfmäßig ausgetragen, wobei sie für gewöhnlich eher unbewegt an Rechnern sitzen. Neu ist dergleichen nicht: Seit je gilt Schach als Sport, des Umstands ungeachtet, dass die Meister hier erst recht regloser am Spielbrett verharren. Gleichwohl wird über Großturniere im Sportteil der Zeitungen, aus den Sportstudios von Fernsehen und Rundfunk berichtet. Denk-Sport: Nichts, so heißt es, fordert das Hirnschmalz unerbittlicher heraus als dieses „Spiel der Könige“. Seit genau zweihundert Jahren wird es im sachsen-anhaltischen Ströbeck bei Halberstadt sogar im Schulunterricht gelehrt und benotet, so wie die „Leibeserziehung“ auch, wenngleich die heute Schulsport heißt. Wenn indes die Ertüchtigung des kombinierenden Verstands derart gewürdigt wird – sollte dann nicht beispielsweise auch die Mathematik, so wie sie über höhere Klassen hereinbricht, als Sport gelten, ebenso die dort gelehrte komplexe Mikrobiologie der Vererbung oder die teils verhängnisvollen Schwierigkeiten, wie sie die französische Sprache oder die unregelmäßigen lateinischen Verben bereiten können? Wer schon einmal verzweifelnd vor einem extraschwierigen Sudoku saß, weiß, wie durchtrainiert ein Denkvermögen sein muss, um es auszuknobeln; nicht viel anders führt so mancher Leitartikel, das eine oder andere Feuilleton in der Süddeutschen oder FAZ unsere rauchenden Schädel über ihre Grenzen hinaus, bis der Schweiß ausbricht. Sind die visionären Manager der Weltkonzerne in Wahrheit Leistungssportler? Darf sich der Verfasser einer Kolumne wie dieser wenigstens mit einem Fünftausend-Meter-Läufer vergleichen? Wer von uns sich gern und ernstlich dicke, anspruchsvolle Bücher vornimmt, weiß gut genug, wie gründlich er seine mentale Konstitution getrimmt haben sollte, bis er sich – im Lesesessel wie angewurzelt – fit genug fühlt für die Bergetappen auf Gipfel der Weltliteratur wie den „Ulysses“ von James Joyce und Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“, Thomas Manns „Joseph und seine Brüder“ oder Marcel Prousts „Recherche". Für Schach bleibt da nicht viel Zeit und Hirn. Dennoch sollen solche Mühen „no sports“ gewesen sein? Immerhin verbraucht unser Zerebrum, das im Körper gerade mal zwei Prozent seines Gewichts ausmacht, stolze zwanzig Prozent der Energie. ■
Alles, bloß das nicht
25. November Nicht leicht lässt sich der Faktor Zeit mit unserem Menschenleben vereinbaren. Alt werden, sagt die Redensart, wollen alle, alt sein mag niemand. Manch einer kommt uns so vor, als wär er niemals jung gewesen; andere bewahren sich noch als Erwachsene ein Stück unbeschwerter Adoleszenz; wieder andere fallen, nach reifen Jahren, am Lebensabend in eine Art Kindheit zurück. Seit unsere Spezies ihr Privileg nutzt, als einzige unter den Tieren über den Tod nachdenken zu können, sehnen sich viele bedenkenlos nach Unsterblichkeit, und der morgige Totensonntag bietet einen geeigneten Termin dafür: ein Tag zwischen morbidem Spätherbst und hoffnungsfrohem Advent. In einer der jüngsten Ausgaben berichtete die Wochenzeitung Die Zeit von aktuellen Forschungen der internationalen „Anti-Aging-Industrie“, eines „rasant aufblühenden Sektors der Pharmabranche“, die das Ziel verfolgt, „die Alterung unserer Organe zu kontrollieren“ und, „quasi als Nebeneffekt“, die durchschnittliche Lebenserwartung auf 120, 150, vielleicht gar 200 Jahre zu erhöhen. Freilich ließe der zweifelhafte Erfolg solchen Ehrgeizes die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 statt auf die ohnehin erwarteten zehn auf 25 Milliarden anwachsen, ganz zu schweigen von den seelischen Folgen für die Psyche, von „all den Verletzungen und Verlusten, die sich ansammeln würden“: „Wären die zu ertragen?“, fragt die Zeit. Unsterblichkeit? Alles, bloß das nicht. In Wahrheit setzt das Streben, sie zu erreichen, nicht den Sieg über das – im Grunde gleichgültige – Alter, sondern über den Verfall voraus. Indem die Ägypter ihre Leichen als Mumien einbalsamierten, glaubten sie sogar, mit dem Körper auch den Geist für immer zu bewahren. Und wirklich: „Die Mumie lebt“, im Kino und im Fernsehen. Dort verbreitet sie, mit tricktechnischen Grausigkeiten sehenswert hochgerüstet, viel Verderben und hat allerlei weitere Zombies und Untote im Schlepptau. An alternde Schönheitsköniginnen gemahnt dies, die unter Schichten von Kosmetik aussichtslos ihre ewige Jugend behaupten. Seit der Antike trachten Kriegsherren danach, sich durch sogenannte Heldentaten und Triumphe im Feld unauslöschlich ins Buch der Geschichte einzuschreiben. Auf ähnliche Erfolge mit friedlichen Mitteln hofften die Künstler. Jetzt mag das anders sein: In keiner Epoche war sich die Welt ihrer Endlichkeit derart bewusst wie in unserer Gegenwart. Weit mehr als von Naturkatastrophen haben wir uns durch selbst verschuldetes Unheil, durch Kriege, Massenmord, Terror, Klimawandel dazu drängen lassen, unseren Begriff von Zukunft auf ein paar Jahrzehnte zu verkürzen. So genügt den Breitenmedien heutzutage alle paar Wochen ein Sensationstor, um einen Starfußballer als „unsterblich“ auszurufen. Dabei vergeht der Ruhm noch gründlicher und schneller als das Leben. Zwar, „dem Glücklichen schlägt keine Stunde“, dichtete Friedrich Schiller, aber ebenso: „Auch das Schöne muss sterben.“ Streben – sterben: Um unserem Sinnen und Trachten den Garaus zu machen, müssen nur zwei Buchstaben die Plätze tauschen. Die letzte Stunde schlägt noch den Glücklichsten unter uns, den unverbesserlichen Optimisten. Und so gehört es sich. Bei aller Schönheit von Welt und Leben: Macht, dass wir das Schlimme in beidem nicht ewig ertragen müssen, uns nicht auch Mut? Der tröstlichste Glaube, dem der Mensch anhängen kann, ist der an Auferstehung, der unmenschlichste der Glaube an Wiedergeburt. ■
Haken und Ösen
11. November Zeige mir, wie du schreibst, und ich sage dir, wie du bist: zum Beispiel „opportunistisch, faul und verschlagen“, weil deine Kritzeleien mit ihren flachen m und n als fade „Fadenschrift“ durch alle positiven Raster fallen. Sofern sich die Buchstaben nach links neigen, sollten wir uns bei dir vor „Selbstbezogenheit“ und „Narzissmus“ hüten. Tendieren sie indes nach rechts, freuen wir uns über deine „ungezwungene Kontaktfreude“ und „Warmherzigkeit“. Sollten aus deinem Bleistift, Kugelschreiber oder Federhalter jedoch senkrechte Zeichen fließen, so wissen wir dich als „besonnen und nüchtern“ zu schätzen, wenn wir dich auch als Langweiler verschmähen … So einfach können Psychologie und Menschenkenntnis werden, wenn wir uns auf die Grafologie verlassen, auf die suspekte „Wissenschaft“ also, die behauptet, Wesenszüge aus einer Handschrift herauszulesen, um sodann die Schreiberin, den Schreiber handsam in einer Schublade zu verstauen. Die zitierten forschen Zuordnungen verdanken sich einer „Karriere-Bibel“ im Internet, die uns leider verschweigt, was die „Sütterlin“ über Geistesverfassung und Gemütslage ihrer Benutzer verrät – unserer Urgroß- und Großväter und -mütter also. Ihnen wurde jene spezifisch deutsche Schreibschrift mancherorts ab 1914, spätestens von 1924 an in allen deutschen Schulen verbindlich beigebracht. Mal geben sich die Zeilen der Altvorderen dornig, spitz und stachelig, mal überraschen sie durch Schleifen, Bögen Rundungen. Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir etliche Buchstaben, die sich nur durch ein Häkchen hier, eine Öse dort voneinander unterscheiden. Darum vermögen sogar Schriftkundige manche Wörter nur schwer und nur aus dem Kontext zu erschließen. Folglich drohen Briefbotschaften, Tagebuchaufzeichnungen, Kochrezepte aus den Manuskriptschätzen von Oma und Opa verloren zu gehen. Um dem entgegenzuwirken, wollen uns etliche Informationsquellen im world wide web, erst recht, im richtigen Leben, einzelne Nostalgiker wie arrivierte Bildungsinstitute im Gebrauch und vor allem im Entziffern der Sütterlinschrift unterweisen. Am heutigen Samstag, zum Beispiel, können von 15 bis 17 Uhr bei einem Workshop im Wunsiedler Fichtelgebirgsmuseum „Anfänger“ lernen, zu „schreiben wie Uroma“. Was wir, vors Problem der Unleserlichkeit gestellt, kaum glauben wollen: Den kratzbürstigen Zeichensatz erfand der Buchgestalter und Grafiker Ludwig Sütterlin 1911 ausdrücklich als griffiges, „schlichtes Vorbild für den Anfangsunterricht“ in Schulen. Zur Grundlage sollte er taugen für die „Entwicklung flüssiger, schöner und deutlicher Handschriften“. Nach der offiziellen Abschaffung durch die Nazis 1941 setzte sich eine gefälligere lateinische „Ausgangsschrift“ durch, die den Grundschülerinnen und -schülern seither in modifizierten Spielarten beigebracht wird. Trotzdem sollten wir – über den zackigen Zeilen aus Großmamas Kochbuch die Köpfe schüttelnd – die heutigen Handschriften nicht voreilig für eine runde Sache halten: Auch in ihnen finden sich widerständige Haken und Ösen die Menge. In allen Fällen drücken Schönschriften und Sauklauen als Spielarten der Körpersprache zumindest andeutend auch unser Inneres aus. Und mit Blick auf die Geschichte verweisen die wechselnden Formen von Geschriebenem zutiefst auf eine je ganz andere Art, zu denken und sich mitzuteilen. ■
Elefant terrible
10. Oktober Unsere Sprache wandelt sich an jedem neuen Tag, und mit ihr das, was wir für wirklich halten. Im Duden, unserem maßgeblichen Wörterbuch, findet sich seit September 2022 neben dem Elefanten auch der Ottifant verzeichnet, eine Kreatur, die sich - ähnlich wie das auf vier Rüsseln einherschreitende Nasobēm des Dichters Christian Morgenstern - der Fantasie verdankt. Bloß für einen verstiegenen Spaß sollten wir jene kleinste Spezies aus der Familie der Elephantidae dennoch nicht halten, jetzt, wo sie zu den Ehren unseres die Wirklichkeit offiziell abbildenden Vokabulars erhoben worden ist und noch dazu greifbar und anschaulich vor wenigen Tagen ihren fünfzigsten Geburtstag feierte. Otto Waalkes, ihr Erfinder, hatte dafür seine Geburtsstadt Emden zum Schauplatz eines Partyspektakels und Spiele-Events ausersehen. Salven von Plüsch-Ottifanten warf er ins dankbar-begierige Publikum. Geschaffen allerdings hat der auch malerisch begabte Komiker das witzige Wesen vergleichsweise beiläufig, 1973 für eine Platte seines Labels „Rüssl Räckords“. Heute verkörpert es die ungebrochene Beliebtheit des Comedians durch Allgegenwart. Aus einer grafischen Mücke ist buchstäblich ein Elefant geworden. Das mag uns animieren, den oft mehr als merkwürdigen Wegen nachzusinnen, auf denen Tiere in unsere Redensarten, in den Duden und andere Lexika gefunden haben. Umso lieber tun wir es, als in Emden beim Ottifantenfest der Bär steppte. Schlau wie ein Fuchs muss Otto sein – und überdies das Herz eines Löwen besitzen –, um mit seinen 75 Jahren immer noch den Clown zu machen, indem er sich kindlich-kindisch aufführt wie der Elefant im Porzellanladen. Zu seinem Erfolgsrezept gehört, einen Bock nach dem anderen zu schießen und den Leuten einen Bären und noch einen aufzubinden. Trotzdem hieße es Eulen nach Athen tragen, wollten wir seinen Fans erst lang und breit erklären, dass auf der Bühne gerade das vermeintlich Leichte oft arg schwerfällt. Irgendwie tanzt ein Humorist ja immer mit dem Wolf: Für ein Zwei-Stunden-Programm muss er ein Gedächtnis haben wie ein Elefant, da beißt die Maus keinen Faden ab, und doch erlebt er bisweilen, dass ein Publikum verständnislos wie der Ochs vor dem Berg seiner Pointen steht, ohne eine Miene zu verziehen. Durfte er sich vor den Zuschauenden am Tag zuvor vielleicht noch wie ein Fisch im Wasser fühlen – jetzt steht er wie ein begossener Pudel da und staunt: Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt ... Um die Katze aus dem Sack zu lassen: Wahrscheinlich haben Kasper, Kabarettisten und andere professionelle Spaßvögel weit mehr Grund für allabendliches Lampenfieber als die Unglücksraben aus dem tragischen Fach. Und um auf die Ottifanten zurückzukommen: Ihre Gleichmütigkeit hat sich Otto Waalkes von ihren selbstbewusst starken, doch sanften Gefährten in der freien Wildbahn Afrikas und Asiens abgeschaut. Der in jedem Fall furchterregende éléphant terrible ist hingegen der „Elefant im Zimmer“, jenes Problem also, das jeden und jede in einer Runde belastet, während niemand sich traut, es offen anzusprechen. Mit solchem Untier des Totschweigens sollten wir den Ottifanten nicht verwechseln, den die Deutsche Post 2017 mit den freundlichen Farben der Pace-Flagge auf eine Sondermarke druckte. Schon gar nicht haben mit ihm die beiden Bronze-Exemplare in Emden-Transvaal zu tun, deren Lippen innig in einem Kuss verschmelzen. Eher ähnelt ihm der grimme Dickhäuter, der im Emdener Otto-Huus vor einem Eimer steht: Auf Knopfdruck kann er kotzen. ■
Das Letzte
6. Oktober Wir sollten dem Unterhaltungsfernsehen nicht alles glauben. Zum Beispiel suggeriert uns ein Titel wie „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, dass es sich bei den Insassen des „Dschungelcamps“ um Künstlerinnen und Künstler von herausragendem Rang handle, doch ist bekanntlich das Gegenteil der Fall. Auch im „Big Brother“-Haus oder dem „Sommerhaus der Stars“, bei „Dancing on Ice“ oder „The Masked Singer“ prostituieren sich vor allem (wenn auch nicht nur) B- und C-Promis, die in seriöseren Formaten keinen Blumentopf gewinnen könnten. Berühmt wird so manche und mancher überhaupt erst durch den Sieg in solchem Wettbewerb, und vielen, die bei „Germany’s Next Top Model“, dem „Bachelor“ oder der „Bachelorette“ gewonnen hatten, blieben kaum ein paar Wochen Zeit, um einen Ruhm zu genießen, der danach verweht war wie ein Hauch verbrauchter Luft. Andere hattentatsächlich einst als Hauptfiguren ihres Metiers firmiert, bis ihrem guten Ruf der Treibstoff ausging: So kamen auch der Schlagersänger Costa Cordalis und der Schauspieler Mathieu Carrière, seine Kollegin Ingrid van Bergen oder Kommunen-Pionier Rainer Langhans im „Dschungelcamp“ an, mithin an einer televisionären Abseite, von der Anhänger gehobenerer Formen von Zerstreuung und Zeitvertreib meinen, viel weiter unten könne man in puncto Niveau nicht aufschlagen. Fans weisen das naturgemäß als elitäres Geschwätz zurück und zeigen auf die „Quoten“. Wirklich schafften es im vergangenen Jahr von den einschlägigen deutschen Showreihen „Let’s dance“ von RTL und „Wer stiehlt mir die Show“ von Pro Sieben mit durchschnittlich jeweils 1,23 Millionen Zuschauern auf den zweiten Platz – getoppt allein von der satirischen „Heute-Show“ des ZDF, die mit gut anderthalb Millionen das Ranking anführt. Dürfen wir also das „Trash-TV“ mit seinen Ekelhaftigkeiten, Nackt- und Bloßstellungen unbesonnen für das Letzte halten, wenn doch helle Scharen unbescholtener Zeitgenossen ihre helle Freude daran finden? Offenbar brauchen nicht wenige gutbürgerliche Seelen zu ihrer Reinigung die Konfrontation mit Übergriffen und Entgleisungen, Fauxpas und Indiskretionen, sofern sich ihnen, in sicherer Distanz, andere aussetzen müssen. Mit trash, also Müll, versorgt uns desgleichen die Kinematografie seit jeher reichlich; in der Reihe „SchleFaZ“ brachten es solche „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ zu modernen Fernseh-Ehren: Seit 2013 ziehen Oliver Kalkofe und Peter Rütten Musterstücke der Leinwand wie „Sharknado“, den „Hausfrauen-Report“ oder „Mutant – Das Grauen im All“ durch den cineastischen Kakao. Doch bald ist damit Schluss: Zum Jahresende stellt Tele 5 die populäre Reihe ein, wie der Sender jetzt verlauten ließ. Mit Intelligenz oder ihrem Fehlen habe eine Vorliebe fürs Müll-Fernsehen und -kino übrigens nichts zu tun, fanden Soziologen heraus: Auch helle Köpfe aus der Oberschicht ziehen sich gelegentlich oder regelmäßig eine line des angeblichen „Unterschichtenfernsehens“ berauschend rein. Dies Wort stammt, nebenbei, von Harald Schmidt, der auch nicht mehr das ist, was er mal war; muss womöglich selbst er, der deutsche TV-Satire-Star der Neunziger, bald in den Dschungel? Seit 2019 gibt es hundert der trashigen „SchleFaZe“ bunt und Schwarz auf Weiß, gedruckt als Buch, zum Lesen. Letzteres gehört indes schon immer zu den erhabenen Techniken hochkultivierter Zivilisationen; es führt uns in die Niederungen der Trash-Presse nach Art der Bild-Zeitung so sicher wie auf den Gipfel des Thomas-Mann’schen „Zauberbergs“. ■
Was Eigenes
3. Oktober Der Aberglaube vieler Mitmenschen verbietet es uns, ihnen bereits vor dem Geburtstag zum Geburtstag Glück zu wünschen. Dies bringe, so weist man uns zurecht und zurück, Unglück. Einem Toten freilich kann nicht mehr viel Schlimmes widerfahren, und wer so viel Ruhm und Nachruhm auf sein helles Haupt geladen hat wie Vicco von Bülow, dem gebühren überhaupt immer und erst recht im Jahr seines hundertsten Geburtstags ein ganzes Jahr lang unsere Gratulationen aller Art. 1923 kam der wohl hintersinnigste Vergnügungskünstler des deutschen zwanzigsten Jahrhunderts – der sich nach dem französischen Namen für das Wappentier seiner Familie, den Pirol, Loriot nannte – in Brandenburg an der Havel zur Welt, am 23. November. Wenngleich heuer bis zu diesem Datum noch 51 Tage vergehen müssen, brechen doch schon die Dämme der öffentlichen Feierwut. Verständlich, hatte die Republik doch mit ihm – so wie seine Fernsehpartnerin Evelyn Hamann mit dem Jodeldiplom – „was Eigenes.“ In Frankfurt/Main stellt das Caricatura-Museum seit vergangenem Mittwoch unterm klassischen Titel „Ach was“ 705 Exponate aus, allem voran berühmte Cartoons von Loriot und Filmszenen aus seinen viel zitierten Fernseh- und Kinokunststücken, doch ebenso unbekannte Fotos, Drehbuchseiten, Entwürfe des erklärten Opernfreunds zu Bühnenbildern; und sogar die „Nachtschattengewächse“ aus dem malerischen Spätwerk treten an den lichten Tag. Am Freitag in einem Monat dann räumt die ARD dem – 2011 in Ammerland gestorbenen – Großmeister einen „crossmedialen Thementag“ ein, dazu eine ganze „Aktionswoche“ in den Fernseh- und Hörfunkprogrammen, der Media- und der Audiothek. Porträtiert wird hier wie da ein Mann für wirklich alle Fälle: nicht einfach ein genialer Witzezeichner, brillanter Regisseur und Schauspieler und grandioser Maskemacher; sondern einer der ganz wenigen Satiriker, die ihren Spott zwar reichlich, indes nicht ätzend ausgossen, nicht als Häme, Hohn und Grausamkeit, sondern aus einer Warte mitmenschlichen Verständnisses, wenn nicht Erbarmens heraus. Überlegen war sein Humor, überheblich nie. In seinen Bildgeschichten, TV-Sketchen und den beiden Leinwandkomödien fasste er den bürgerlichen Deutsch- und Durchschnittsmenschen ins Auge, als kuriose Urzelle der Nachkriegsgesellschaft: In dessen Wunderlich- und Unverbesserlichkeiten beschreibt er ihn beim Umgang mit Eiern und Einbrechern, mit Hunden, Kindern und anderen Tieren, er begleitet ihn ins Bett und ins Badezimmer („Die Ente bleibt draußen!“), zur Erwachsenenbildung und an den Parkautomaten mit dem „für den Münzeinwurf vorgesehen Münzeinwurf“, oder er sprengt ein Atomkraftwerk („Muss das sein … ?“). Loriots Kunst und Können offenbaren das ganz normale, nämlich oft genug verkrachte Alltagsleben als Zeichen und Wunder im Privaten wie in der Politik: wenn er, zum Beispiel, im Bundestag vor der „Nudelkrise“ warnt oder im Restaurant erleben muss, wie wegen einer Nudel an der Lippe die gefühlvolle Annäherung an die Dame seines Herzens scheitert, wenn er als muffiger Spießer aufräumend ein fremdes Wohnzimmer verwüstet („Das Bild hängt schief“) oder als dickblütiger Chef verzweifelnd einvernehmlichen Körperkontakt mit seiner Sekretärin versucht: „Andere machen es doch auch!“ Wer mit Loriot lacht, lacht die Menschen nicht aus, sondern über sie, was meistens heißt: auch über sich selbst. Dass wir ihn hatten: welch ein Glück. ■
Deutsch mit Mängeln
29. September Was hat Deutsch mit Chinesisch und Finnisch, Arabisch und Isländisch gemeinsam? Unsere Sprache gehört, wie die anderen genannten, nach Auskunft der Unesco zu den zehn schwierigsten auf Erden. Nun könnten wir meinen, wir als Einheimische dürften uns freuen, ein so hochkomplexes Verständigungsmedium nicht erst mühsam in der Schule lernen zu müssen, sondern es gleichsam mit der Muttermilch einzusaugen. Weit gefehlt indes: Sogar wir Muttersprachler geraten leicht ins Schlingern angesichts der zahllosen Seltsam- und Widersprüchlichkeiten unseres Wortschatzes und unserer Grammatik. „Medienkompetenz sehr gut, deutsche Sprache mangelhaft“, titelte der Deutschlandfunk Kultur schon im Jahr 2012, als er über „massive Lücken“ in den orthografischen und grammatischen Kenntnissen deutscher Studienanfänger an philosophischen Fakultäten berichtete; auch in den Jahren 2014, 2018 und so fort klangen entsprechende Verlautbarungen nicht viel optimistischer. Zum Beispiel beklagten Professoren der Zürcher Uni Im vergangenen Jahr einen „zum Teil abenteuerlichen Umgang mit der deutschen Sprache in studentischen Arbeiten“. Das Problem zeichnet sich schon lange vor dem Abitur ab: Heuer im Mai ermittelte das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, dass jeder vierte Viertklässler im Lande nicht richtig zu lesen und zu schreiben versteht. Schmerzlich kommt hinzu, dass junge Leute neben Methoden korrekter Wortwahl, Rechtschreibung und Syntax offenbar auch viele Begriffe unserer Hoch- und Alltagssprache aus dem Sinn verlieren, die Wert und Gewichtigkeit besitzen und vielen älteren Zeitgenossen lieb geworden sind. Wer etwa heute vor einer Reise sein Zeug oder seine Sachen zusammenpackt, hat das vor noch wenigen Jahrzehnten mit seinen Habseligkeiten getan – ein Wort, dessen Bedeutung die meisten zwölfjährigen Jungs und Mädchen eines humanistischen Gymnasiums in der Region schon nicht mehr kennen, wie die Latein und Deutsch unterrichtende Ehefrau des Schreibers dieser Zeilen zur Kenntnis nehmen musste. Obendrein verschwindet mit Wörtern solcher Art auch ein Gutteil Wohllaut aus unserem Gesprochenen. Als 2004 das Goethe-Institut und der in Wiesbaden ansässige Deutsche Sprachrat nach dem „schönsten deutschen Wort“ fragten – und Antworten aus 111 Ländern erhielten –, gelangten, sehr zu Recht, besagte Habseligkeiten auf Rang eins. Den zweiten Platz besetzte die Geborgenheit, jene Art von Nestwärme, wie sie nicht zuletzt von einer achtsam gepflegten Muttersprache ausgeht. Nicht alle aussterbenden Wörter sind, nur weil sie alt sind, auch altmodisch. Dass freilich farbig tönende Preziosen wie der Hagestolz und das Hasenpanier, das Labsal (für eine genussreiche Erfrischung) oder der Eidam (für den Schwiegersohn) ungeachtet ihrer Plastizität untergehen oder -gingen, ist notgedrungen dem zeitgemäßen Wandel und anpassungsfähigen Fortschritt unserer Sprache geschuldet und muss selbst von den Traditionsbewusstesten unter uns hingenommen werden. Wenn uns also ein Macho mit zu viel Gel in der Frise unangenehm auffällt, weil er reihenweise geile Girlies anmacht, die nicht bei drei auf dem Baum sind, sollten wir von ihm nicht als von einem Pomadenhengst schwadronieren, der mit jeder liebreizenden Maid poussiert. Sonst müsste es vielen – und nicht nur jungen – Leuten so vorkommen, als sprächen wir chinesisch, arabisch oder finnisch mit ihnen. ■
Der Pandora-Effekt
23. September Immer mehr Menschen, Institutionen, Veranstalter meinen es immer besser mit uns. Damit nichts unser Gleichgewicht in der bedrohlich trudelnden Welt behellige, senden sie allenthalben sogenannte Triggerwarnungen aus, sobald sie fürchten, in ihren Angeboten stecke Störendes und Verstörendes, das uns irremachen oder gar traumatisieren könnte. So führt das Staatsschauspiel Dresden seit einigen Wochen die „Lulu“, Frank Wedenkinds „Skandalstück“ um die Nymphomanie eines „wilden, schönen Tiers“, mit einem Mann in der Titelrolle auf und weist empfindliche Gemüter sicherheitshalber darauf hin, dass der Protagonist, seine (biologische) Geschlechterzugehörigkeit untermauernd, immer mal wieder die Hose fallen lässt. Vor gut einem Jahr sahen wir uns schon einmal an dieser Stelle genötigt, Skepsis gegen die um sich greifende Praxis laut werden zu lassen. Seit Kurzem nun triggern uns neuerlich Triggerwarnungen, diesmal gleichsam auf einer Metaebene: Es irritiert uns nämlich kein bestimmter Trigger – also kein Akut-Auslöser für etwas mental Unliebsames –, sondern die aktuelle Berichterstattung über derlei Alarmzeichen. Zum einen vermelden viele Medien, dass TV-Sender, die alte Folgen der „Otto-Show“ oder von „Schmidteinander“ ausstrahlen, zuvor Hinweisschilder einrücken, die zu vorsichtigem Genuss raten: „Das folgende fiktionale Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.“ Zum andern kommt ein Trigger-Trigger, eine Warnung vor der Warnung, aus den Vereinigten Staaten in Form seriös ermittelter Forschungsergebnissen zu uns. Sie belegen nicht zuletzt den „Pandora-Effekt“, jene uns offenbar eingeborene pressante Neugier, mit der wir uns ausgerechnet solchen Reizen, Dingen und Situationen aussetzen, die absehbar unseren Widerwillen hervorrufen, wenn nicht gar unangenehme Folgen für uns zeitigen. „Insgesamt haben wir festgestellt, dass Warnungen keinen Einfluss auf die den Gemütszustand betreffenden Reaktionen auf negatives Material haben“, schreiben die Forschenden um Victoria M. E. Bridgland im angesehenen Magazin Clinical Psychological Science. „Allerdings verstärken die Warnungen zuverlässig den antizipatorischen [vorwegnehmenden] Affekt.“ Vieles also deutet darauf hin, „dass die Warnungen die Beschäftigung mit negativem Material unter bestimmten Umständen sogar noch verstärken“. Aber das haben wir ja schon als Kinder am eigenen Leib erfahren: als wir bevorzugt eben jenen riskanten oder delikaten Phänomenen der Erwachsenenwelt nachforschten, die Mama und Papa vor uns geheim und im Verborgenen halten wollten. Hinzu kommt die unterschiedliche Bedrohlichkeit dessen, das den Alarm auslöst: Zweifellos zwar sollten Migräniker auf den Einsatz von Stroboskop-Blitzen hingewiesen werden, weil sie Schmerzattacken auslösen können; hingegen sind mahnende Ansagen, aktive Nacktheit betreffend, längst sinnlos geworden: Schon viele Zwölfjährige haben sich mit allen, selbst harten Formen der Pornografie vertraut geamcht. Zeitlose Gültigkeit dürfen indes die berühmtesten Tragödienverse aus der „Antigone“ des antiken Griechendichters Sophokles beanspruchen: „Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch“ – eine Triggerwarnung vor dem Ungeheuer, das in jedem von uns steckt. Sie ist 2465 Jahre alt und gilt noch immer. ■
Ross und Reiterin
23. September Eine junge Dame hoch zu Ross beeindruckt viele von uns weit stärker als ein alter weißer Mann auf einem Gaul. Von den Legionen reitender Kriegsmänner – wie den Skythen und Hunnen, den Magyaren oder den Mongolen Dschingis Khans – sprechen wir mit mehr Grauen als Hochachtung; umgekehrt verhält es sich bei den sagenhaften, nicht minder grausamen Amazonen: Die verlangen uns eine gewisse Bewunderung ab. Bis in die jüngere Vergangenheit war das Reiten vornehmlich eine Angelegenheit für ganze Kerle und feine Herren, was sich in der Literatur spiegelt. Sofern dort Damen zu Pferde sitzen, so ists stets etwas Besonderes: Aus George R. R. Martins Fantasy-Epos „Das Lied von Eis und Feuer“, dem belletristischen Ursprung des TV-Serienhits „Game of Thrones“, strahlt Daenerys Targaryen auf ihrer Stute „The Silver“ edelmetallisch heraus; im „Herrn der Ringe“ von J. R. R. Tolkien zieht die schöne Éowyn auf ihrem stattlichen Renner „Windfola“ in die Schlacht (wofür sie sich allerdings als Mann verkleidet); in James Fenimore Coopers „Lederstrumpf“-Roman „Der letzte Mohikaner“ traben die ungleichen Schwestern Alice und Cora Munro durch die Gefahren der Wildnis; natürlich wollen wir „Die Frau, die davonritt“ – aus D. H. Lawrences Novelle – nicht links liegen lassen, die ihre Familie verlässt, um in einem altmexikanischen Ritual einen erotischen Tod zu finden; genauer freilich erinnern wir uns an Pippi Langstrumpf, von ihrer Erfinderin Astrid Lindgren stabil auf dem Rücken des Wallachs „Kleiner Onkel“ platziert. Im Lauf der Kriegs- und Kunstgeschichte galt kaum eine Frau als ‚groß‘ genug, dass die Mit- und Nachwelt sie respektvoll mit einem Reiterstandbild hätte verherrlichen wollen. Diese Spielart des Denkmals, durch Lebens-, wenn nicht Überlebensgröße geradezu aufdringlich unübersehbar, blieb siegreichen Kriegsherren und triumphalen Machtmännern vorbehalten, wenn auch nicht ausschließlich. So schreiben die Franzosen ihrer Nationalheldin, der 1431 im Hundertjährigen Krieg verbrannten Jeanne d’Arc, neben frommer Duldsamkeit auch eine derart heroische Autorität zu, dass sie Idealgestalten der „Jungfrau von Orleans“ wiederholt kolossal in Bronze aufrichteten, so 1855 in Orleans selbst, 1893 in Chinon, 1900 in Paris. Ganz anderes findet sich in der sizilische Kleinstadt Scicli: Dort zermalmt eine Marien-Figur, die Madonna delle Milizie, sarazenische Aggressoren unter den Hufen eines steil auf der Hinterhand steigenden Pferds. Politikern und Politikerinnen der jüngeren und jüngsten deutschen Geschichte wurde die Ehre eines Reiterstandbilds nicht zuteil – mit einer Ausnahme: 2021 hatte der Künstler Wilhelm Koch vor dem Tempel-Museum in Etsdorf, einem Flecken im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach, Angela Merkel auf ein Ross aus dem 3-D-Drucker gesetzt. Weil der Zügel fehlte, behielt die Exkanzlerin die Hände frei, um damit ihre charakteristische „Raute“ zu formen. Länger als zwei Jahre waren dem Monument indes nicht beschieden: Verrottet brach es vor wenigen Tagen in Stücke. Eine symbolische Bedeutung sollten wir dem Ereignis aber nicht zuschreiben, verließ doch die Politikerin ihr hohes Amt aus freiem Willen und nicht, weil sie gestürzt worden wäre. Nicht als Kriegerin, jedoch notorisch kämpferisch hat sie von der Finanz- bis zur Coronakrise alle Hürden unbeugbar genommen. Sportliche, womöglich reiterliche Ambitionen sind von ihr hingegen nicht bekannt. Immerhin wandert sie gern, wobei sie sich, statt auf vier Hufen, auf den eigenen zwei Füßen fortbewegt. ■