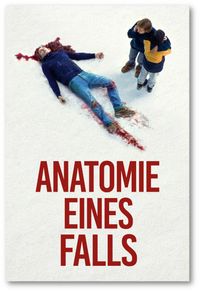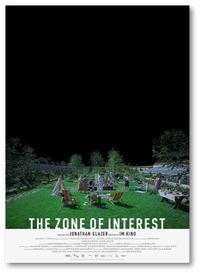Die erste Katze auf dem Mond
- Im Kino: To the Moon (USA, 2024, Regie: Greg Berlanti, 133 Minuten)
Von Michael Thumser
16. Juli – Na klar: Die CIA hat John F. Kennedy ermordet, … und die US-Regierung inszenierte selbst den New Yorker Terror von nine eleven, … und mittels toxischer Kondensstreifen aus Düsenflugzeugen kontrollieren ruchlose Regierungen ihre arglosen Untertanen … Auf der Liste der zehn populärsten Verschwörungserzählungen rangiert auf einem Spitzenplatz desgleichen jene, die behauptet, die 1969 weltweit bestaunten TV-Bilder der ersten Menschen auf dem Mond seien eine dreiste Fälschung der Nasa und in Wahrheit im Studio entstanden. Wie es dazu gekommen sein könnte, fantasiert das Retro-Lustspiel „To the Moon“ zusammen. In übergroßen wie in verliebten Bildern und mit spritzig-spitzen Dialogen malt Regisseur Greg Berlanti ein amüsantes Märchen aus, worin ein hübsches Mäuschen aus dem Irgendwo Zutritt zum innersten Kreis des Apollo-Programms und die Oberhand über einen führenden Raketentechniker erlangt, der sich vor schwarzen Katzen fürchtet.
Fly me to the moon, sang samtig Frank Sinatra 1964. Nicht freilich um den Wunsch des Entertainers zu erfüllen, setzte in den Sechziger-Jahren die Nasa alles daran, bis zum Ende des Jahrzehnts Menschen auf den Erdtrabanten und zurück zu befördern. Vielmehr folgte die amerikanische Raumfahrtbehörde einem Versprechen des Präsidenten John F. Kennedy, das einem Befehl gleichkam: Der Sowjetunion galt es den Vorsprung abzujagen, den sich der Systemfeind seit dem Start des ersten Sputnik-Satelliten 1957 nicht nehmen lassen wollte.
Smarte Schönheit
Während im All der Fortschritt futuristisches Format annimmt, „geschehen auf Erden furchtbare Dinge“. In Vietnam bringt der Krieg die USA immer blutiger in Bedrängnis. Also zieht die Administration dringend benötigte Gelder vom astronomisch teuren Weltraumprojekt ab, für das sich Politiker und Bevölkerung kaum noch interessieren. Bis sich die smarte Schönheit Kelly einmischt: Zügig bringen Impertinenz, Sprech- und Organisationstalent der jungen Publicity-Fachfrau das Apollo-11-Programm wieder auf die ersten Zeitungsseiten und in Blüte. Die Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins, statt unter Zeitdruck für die riskante Raumreise zu trainieren, plustern sich fortan fotogen als Werbeträger für teure Armbanduhren auf oder posieren optimistisch neben Nobel-Sportwagen. (Selten wurden Luxusmarken durch product placement so unverfroren ins Bild gebracht wie in diesem Film.) „Wenn ich mit meiner Hilfe fertig bin“, plappert Kelly siegessicher, „werden diese Männer berühmter als die Beatles sein.“
Dass indes eine so todernste, weil lebensgefährliche Angelegenheit wie die Mondmission zum „Unterhaltungsprogramm“ auf irdischen Bildschirmen und zu den bunten Bildchen kindischer Reklame verkommt, das will Cole Davis, dem für den Raketenstart verantwortlichen Ingenieur (unerwartet flach und strahlungsarm: Channing Tatum), gar nicht schmecken. Dabei weiß er das Schlimmste noch gar nicht: Das Weiße Haus will „auf Nummer sicher“ gehen, weswegen Kelly auf Geheiß des dubios-dämonischen Agenten Berkus (Woody Harrelson) parallel zum Apollo- ein streng geheimes „Artemis-Projekt“ einfädeln muss - in einem abgelegenen Hangar die Simulation des ersten menschlichen Tritts und Schritts auf der Mondoberfläche nebst Stars and stripes-Fahne, Gedenktafel und dem Schwindel schwereloser Riesensprünge. Also doch: alles Lug und Trug?
Charisma und Sixties-Schick
Als Spezialistin für beides könnte tatsächlich Kelly dienen, lässt doch ihre vernebelte Biografie eine Vergangenheit als Hochstaplerin, wenn nicht als Ganovin ahnen. Der schillernden Scarlett Johansson mit ihrem charismatischen Glanz, den Zauberkräften ihres spitzbübisch beweglichen Gesichts, dem Sixties-Schick ihrer von Szene zu Szene wechselnden Junge-Damen-Garderobe wäre man selbst dann nicht gram, entpuppte sie sich als Saboteurin des „größten Menschheits-Abenteuers“. Doch geht es ihr um das genaue Gegenteil. Ihre Devise: „Werbung ist Betrug, nur dass er hier legal geschieht“ - das sagt sie mit verführerisch manipulierendem Mund. Schwindelerregend und wie schwerelos verschwendet sie ihren schier unerschöpflichen Charme, um Nasa-Bosse und US-Senatoren widerstandslos um ihre übergriffigen Finger zu wickeln.
Dass die Mondlandung von 1969 kein frivoler Fake war, daran lässt der Film natürlich keinen Zweifel. Darf mithin die Kinogemeinde damit rechnen, künftig auch den übrigen Verschwörungsunsinn Stück für Stück auf der Leinwand demontiert zu sehen? Das eher nicht. Immerhin handelt es sich bei Greg Berlantis zwar ziemlich langer, aber doch recht kleiner kosmischen Komödie selbst um ein bloßes Hirngespinst, das seine blühenden Fantastereien und romantischen Unwahrscheinlichkeiten nicht zu hinterfragen braucht. Wenigstens die beiden größten Rätsel der Raumfahrtgeschichte löst das Lustspiel auf: ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist; und warum 1969, außer den drei Männern, auch erstmals eine Katze den Mond betrat.
Die Zeit, die bleibt
- Im Kino: Die Herrlichkeit des Lebens (Deutschland/Österreich, 2024, Regie: Georg Maas [auch Drehbuch, nach dem Roman von Michael Kumpfmüller], 99 Minuten)
Von Michael Thumser
4. Juli – In F. Scott Fitzgeralds Kurzgeschichte „Der Rest von Glück“ aus dem Jahr 1920 verliert eine Frau Mitte zwanzig den Mann ihres Herzens, einen Schriftsteller, als ein Tumor im Hirn ihm die Persönlichkeit raubt. Im Kinodrama „Die Zeit, die bleibt“ (das die Hofer Filmtage 2006 in deutscher Erstaufführung herausbrachten) erzählt der französische Regisseur François Ozon von einem jungen Modefotografen, dem ein Arzt eröffnet, ihm blieben, eines unheilbaren Tumors wegen, nur mehr Monate. Im richtigen Leben hat die 25-jährige Dora Diamant den tuberkulosekranken Dichter Franz Kafka während seiner letzten Lebensmonate begleitet und hingebungsvoll gepflegt. An der Schwelle zu seinem Tod vor hundert Jahren, am 3. Juni 1924, erfüllte sich für ihn in der Begegnung mit ihr vielleicht zum einzigen Mal „die Herrlichkeit des Lebens, die um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, in der Tiefe, unsichtbar, aber sie liegt dort, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie beim richtigen Namen, dann kommt sie.“
Den Tagebucheintrag notierte Kafka bereits im Oktober 1921 – eine der Freiheiten, die Regisseur Georg Maas sich für seinen Film „Die Herrlichkeit des Lebens“ unwidersprochen nehmen durfte. Denn nicht auf eine zum aktuellen Feierjahr passende literaturhistorische Dokumentation legten er und Kamerafrau Judith Kaufmann als Co-Regisseurin es an. Stattdessen spürt ihr poetisches Leid- und Liebesdrama der vielleicht flammendsten, wahrscheinlich schönsten, jedenfalls der letzten Liebe Kafkas nach.
Dabei wiegen Dramaturgie und Bilder eine feine Balance aus. Nie liegt der Fokus auf dem überprominenten, weil weltweit meistgelesenen deutschsprachigen Autor allein, dem Sabin Tambrea die Zerbrechlich- und Feinnervigkeit eines Dandys verleiht, freilich ohne der oberflächlichen Selbstverliebtheit des Typus zu erliegen, auch ohne die weltfremde Skurrilität, mit der Joel Basman den Schriftsteller unlängst in einer sechsteiligen ARD-Serie interpretierte. Mindestens mit gleichem Nachdruck wie Kafkas Naturell und womöglich intensiver öffnet sich das Wesen Dora Diamants: Die faszinierende Henriette Confurius verschleiert und offenbart zugleich hinter ihren fast mädchenweichen, gleichwohl charakteristisch ausdrucksvollen Zügen den Eigenwillen einer Frau von autonomer Intelligenz, die gleichwohl bereit ist, sich ohne Unterwürfigkeit dem bestaunten Künstler, dem vergötterten Geliebten zu verschreiben.
Toter Mann
„Können Sie ‚toter Mann‘?“, fragt Dora, die Kindergärtnerin aus Berlin, im Küstenwasser des Ostseebads Graal-Müritz den Dichter. Sogar am sommerlichen Meer ging er immer hochgeschlossen bis zum Hals einher, bis er nun endlich Hut, Dreiteiler und Krawatte ablegt, um mit der neuen Bekannten reglos eine Weile auf den Wellen zu schweben. Heimlich beobachtete er zuvor Doras Tanz am Strand, ein Eindruck, der ihn „auf eine verstörende Weise berührt“. Und er fragt und wünscht sich: Sollte er, als Kranker schon fast ein toter Mann, doch an einer „Schwelle des Glücks“ angelangt sein?
Seinem treuen Freund – und späteren Nachlassverwalter – Max Brod schreibt er darüber in einem Brief, aus dem - und vielen weiteren originalen Texten - der renommierte Romancier Michael Kumpfmüller 2011 in „Die Herrlichkeit des Glücks“ zitierte. Dem Roman folgen das Drehbuch von Georg Maas und seinem Mitautor Michael Gutmann zusammen mit der Kamera Judith Kaufmanns, ohne den Text recht eigentlich zu verfilmen. Eine eigenständige visuelle Erzählung kondensierten und komponierten sie daraus, zeitenthobene Momente der Erfüllung, leichte Trauer, überhaupt konträre Atmosphären. Von der sommerwarmen Weite des Meeres und des strahlenden Lichts darüber wechselt die Szenerie hinüber in die Schattenwelt der Stadt und die Enge einer schäbigen Berliner Wohnung, deren feuchte Kälte dem weit fortgeschrittenen Lungenleiden Kafkas den Rest gibt. Einmal, im Gespräch, hustet er Dora unvermittelt einen Blutnebel ins Gesicht.
Abhängigkeiten
Explizit selbstbestimmt entscheidet sie sich, die finale Erdenstrecke des Sterbenden gemeinsam mit ihm zu gehen. Anders er: Zahlreich fesseln ihn Abhängigkeiten – etwa die vom herrischen Vater, dem er selbst am Telefon duckmäusernd wie ein banger Knabe begegnet; die Abhängigkeit von seiner Familie, die vermeintlich weiß, was das Beste für ihn ist; zuallererst jene von der Krankheit, die qualvoll auf den Kehlkopf übergreift. Wenigstens eine Ahnung von Befreiung wird ihm durch Dora zuteil, wenn die junge sozialistische Ostjüdin ihn der Religion seiner Väter näher bringt; wenn sie sich gegen die Oktroyanz seiner Familie durchsetzt; wenn sie deren Zwängen und seiner Gezwungenheit ihre stille Lebensfülle entgegenhält. In einem höheren und tieferen Sinn versteht sie sich mit ihm, und versteht ihn noch dann, als er verstummt – im Sanatorium in Kierling nahe dem österreichischen Klosterneuburg geht ihm am Ende die Stimme verloren, das Sprechen, ihm, dem Dichter, die Sprache.
Verwandelt hat Dora ihn trotzdem – zeichenhaft reflektiert in „verstörenden und berührenden“ Spiegelbildern Kafkas, während er, unruhig durchs Zimmer tigernd, den Anfang seiner berühmtesten Erzählung kritzelt, der (in Wahrheit schon 1912 entstandenen) „Verwandlung“: Er ist Einer, und ein vielfältig Anderer auch. Nicht lang darf er den anderen, neuen Weg mit Dora einschlagen. „Die Laufrichtung ändern“: Das empfiehlt zwar zynisch die Katze der Maus in der Parabel-Fabel, die Kafka gleich eingangs am Strand einer Kinderschar vorträgt. Dem Rat selber zu folgen, ist ihm aber schon nicht mehr gegeben. Immerhin bleibt ihm ein Rest, ein Rest von Glück.
■ Lesenswerte Informationen über Dora Diamant in der Neuen Zürcher Zeitung: hier lang.
Die Furchtbarkeit des Menschen
- Im Kino: Sterben (Deutschland, 2024, Regie und Buch: Matthias Glasner, 182 Minuten)
Von Michael Thumser
6. Juni – In der Klassischen Musik gibt es eine gespenstische Vortragsbezeichnung: morendo – ersterbend, verschwindend. In eben der Art, verlangt Komponist Bernard, müsse sein Werk dirigiert und gespielt werden: „sterbend“. Darum heißt es auch so: „Sterben“; wie Matthias Glasners neuer Film: eine dreistündige, das Gemüt gehörig strapazierende Tragödie. Schon jetzt rangiert sie unter den herausragenden deutschen Kinoereignissen des gesamten Jahres.
Der da am Pult steht, um die Symphonie seines Freundes einzustudieren, Tom Lunies, sieht sich selbst vom Tod, von Sterbenden umstellt. Bernard (Robert Gwisdek, mit dem Gottsuchergesicht eines Dostojewski), seit jeher „ins Leiden verliebt“ und seines noch recht jungen Lebens unwiderruflich müde, mutet ihm zu, seinen Suizid zu decken. Toms Mutter Lissy, etwa siebzig, geht längst am Stock und fährt halb blind Auto, lässt nachts unter sich und übersteht beiläufig einen Herzinfarkt, bevor sie, nächstens, unrettbar einem Krebsgeschwür erliegen wird. Im Kopf von Vater Gerd dämmert sein gütiger Verstand dem Dunkel der Demenz entgegen; der grauenhaft authentische Hans-Uwe Bauer gibt ihn in seiner orientierungslosen Aufgebrauchtheit grandios beängstigend. Toms Schwester Ellen (Lilith Stangenberg, so spröd wie verletzlich) findet nur zu sich und anderen, solange sie sich im Alkohol verliert.
Eine dysfunktionale, seit Toms Kindheit schon zerfallene Familie: In aller Ausführlichkeit und makabrer Ruhe führt Glasner sie an die Grenzen der mentalen Belastbarkeit. Als in der längsten Szene Sohn und Mutter sich vielleicht zum ersten und zum letzten Mal aussprechen, bekennen sie einander, „furchtbare Menschen“ zu sein, voll von „schrecklicher Leere“. Aus Dialogen und Episoden solcher Art dringt niemals Pathos – eine der Seltsamkeiten und Mirakel dieses Films –, obwohl der Regisseur, der auch der Autor ist, die Figuren mit Unglück nachgerade flutet. In Einsamkeit verharren sie, wehrlos gegen Hinfälligkeit und Kraftverlust. Toms Ex gebiert, von ihm achtsam gehalten, das Kind ihres Neuen, eine andere wird von ihm schwanger, doch ums Sterben gehts auch dann, wenn es ums Leben geht, und kommt Liebe ins Spiel, dann auch der Tod.
Ohne Hoffnung?
Dass so viel Leid und Ruin, Erschöpfung und Isolation im Lauf von fünf Kapiteln und einem Epilog nicht abstumpfend ihre Dringlichkeit verlieren, ist der Ursprünglich- und Momentgenauigkeit der Inszenierung zu verdanken. Wie aus dem Stegreif folgt Jakub Bejnarowiczs Kamera den Gestalten, wie improvisierend agieren die Darstellerinnen und Darsteller, die allesamt morendo ihre Kunst und Künste in spektakulärer Einzigartigkeit ausbreiten. Als Ensemblestück fasziniert der Film, der gleichwohl Corinna Harfouch und Lars Eidinger in den Fokus nimmt: sie, als Lissy, in sich selbst verschlossen wie in einem Bunker oder Kerker, halb gelähmt von Krankheit, zugleich blockiert von verstummter Todesangst; er, der Berliner Bühnenstar, ohne eine Spur einst üblicher Allüren als ihr Sohn Tom, preisgegeben seinem stillen Entsetzen vor all dem Trennenden, den Abstürzen, dem Scheitern in ihm und um ihn her.
Sein Jugendorchester lässt ihn bei einer zähen Probe wissen, es halte Bernards Werk für „viel zu lang“ (was dieser lange Film nicht ist) und „ohne Hoffnung“. Ein Vorwurf, den auch Matthias Glasners familiäres Endspiel trifft? Ein Friedhof zwar – genauer: „Ruhewald“ – gibt seinen letzten Schauplatz ab, neben Mutters Urne aber, immerhin, hebt Tom ein strammes Baby in die Höhe. Den Musikerinnen und Musikern hat er erläutert, in Bernards bedeutungsvoller (von Lorenz Dangel berückend ausgeführter) Symphonie „entsteht so etwas wie Erlösung, Frieden, Transzendenz. Die einzige Frage ist: Ist das noch unsere Welt?“ Wahrlich: die Frage aller Fragen.
Das Siegerfoto
- Im Kino: Civil War (Großbritannien, USA, 2024, Regie und Buch: Alex Garland, 109 Minuten)
Von Michael Thumser
27. April – Vor den nadelspitzen Wolkenkratzern der Skyline von Manhattan steigt steil eine graubraune Rauchsäule himmelwärts: Es herrscht Krieg in den Vereinigten Staaten, beinah das schlimmste Unheil, das ein Volk treffen und nur von einem noch schlimmeren getoppt werden kann: von Bürgerkrieg, „Civil War“. Seit 1865, seit dem Ende des Gemetzels zwischen den Nord- und Südstaaten um die Abschaffung der Sklaverei, haben die USA keinen Krieg mehr auf eigenem Territorium erleben müssen. Jetzt tobt dort einer.
Welche Streitfrage god’s own country diesmal zerreißt, bleibt in Alex Garlands Film ungenannt und fällt nicht ins Gewicht. So tief reicht die Spaltung, dass die von den Bundesstaaten Kalifornien und Texas formierten Western Forces als unaufhaltsame Streitmacht gegen die Ostküste vorstoßen; ihr Ziel: Washington. Die Hauptstadt und mit ihr der namenlos bleibende, verfassungswidrig in dritter Amtszeit herrschende Präsident hinter den Festungsmauern seines Weißen Hauses stehen kurz vor dem Fall. Darum macht sich ein Reporterquartett, angeführt von der Fotografin Lee (Kirsten Dunst), im Auto auf den 875 Meilen langen Weg von New York nach „D.C.“, in der Hoffnung, gerade noch rechtzeitig für ein letztes Interview mit dem Autokraten anzukommen. Zum Höllentrip und -ritt gerät die Reise entlang bluttriefender Variationen zum dröhnenden Grundthema Flucht, Folter, Massenmord. Während der wenigen Tage der Tour, so bekennt die noch fast kindliche Jessie (Cailee Spaeny) ihrem Idol Lee, habe sie schrecklichste Ängste durchlitten – und sich doch noch nie „so lebendig gefühlt“.
Rechtsfreie Räume
Längst haben sich letzte Reste bürgerlicher Moral aufgelöst. Durch einen Flickenteppich rechtsfreier Räume leitet Alex Garlands Roadmovie die beiden Frauen und zwei männlichen Kollegen. In schonungslos authentischen Szenen reiht der britische Regisseur und Drehbuchautor im Verein mit seinem Kameramann Rob Hardy Impressionen der Totalvernichtung aneinander: Auf einem Highway stehen ausgebrannte oder ineinander verkeilte Autos wie in einem eingefrorenen Stau, an einer Tankstelle martern Marodeure sadistisch blut- und schleimklumpige Gefangene, ein Kipplaster füllt mit Dutzenden toter Zivilisten ein Massengrab, aus dem Jessie nur mit knapper Not entrinnt …
Nicht wesentlich unterscheiden sich die Kriegsbilder von den Filmberichten, wie sie die Medien unablässig aus den realen Konfliktgebieten der Welt frei Haus liefern. Hier freilich steigern sich die Gewaltorgien zu einer schwer erträglichen Entsetzlichkeit, weil sie nicht aus einer fernen Fremde stammen, sondern sich den Zuschauenden aus unmittelbarer Nähe als Zerstörer der eigenen Zivilisation aufzudrängen scheinen. Umso entschlossener halten die Kriegsberichterstatter innere Distanz: „Wir fragen nicht“, formuliert Lee schmallippig ihr journalistisches Credo, „wir zeichnen auf.“ Und nebenbei räumt Kollege Sam altersweise ein: „Ruhe wäre nichts für uns.“ Ihrer aller Leben ist das Sterben unbekannter anderer. Immer neue Meucheleien und Massaker dokumentierend, klammern sie sich Tag für Tag wahllos und hautnah an irgendwelche Kombattanten, um panische Gesichter, schreiende Münder, spritzende Schlagadern, zerfetzte Leiber abzulichten. Beim Duell zweier Scharfschützen gehört zu den nicht gestellten Fragen auch die, wer von ihnen für welche Seite kämpft.
Eine Variante der Gegenwart
Von gelegentlichen dramaturgischen Unbeholfenheiten und schauspielerischen Durchhängern lenken gründlich die furchterregenden Grausamkeiten ab, die in Alex Garlands zunehmend nervenzerrender Dystopie keinen geilen Voyeurismus bedienen: Zwar ähneln die Schockeffekte durchaus jenen des Splatterkinos, haben aber trotzdem nichts mit ihnen gemein. Überhaupt lässt sich die Produktion – die den Vergleich mit dem aktuell tief gespaltenen Real-Amerika nicht explizit zieht, allerdings aufreizend provoziert – kaum einem Genre zuordnen: Eigenartiger- und unsinnigerweise firmiert sie sowohl als Science-Fiction- wie auch als Kriegsfilm, aber statt in einer futuristisch aufgepeppten Zukunft spielt sie in einer bedrückend realistischen Variante der Gegenwart; und obwohl sie im letzten Drittel, beim granatenkrachenden Barrikadenkampf und Showdown in Washington, packend die Standards des Militärdramas durchdekliniert, fehlt ihr alle Parteilichkeit und jedes Heldenpathos. Das historische Foto, das am Ende, rasend vor waghalsiger Gier, ausgerechnet die Anfängerin Jessie schießt, es zeigt lauter lachende Gewinner einer Schlacht, aber keine Sieger im Kampf ums gerechte Gute. Zu den Opfern der grassierenden Entmenschlichung zählen desgleichen abgestumpfte Medien-Kämpen vom Schlage Lees: Über gelegentlich drohende Abgründe der Angst hinweg hat sie die kalte Panzerung ihrer nicht mehr traumatisierbaren Seele vollendet.
Solche Widersprüchen geben dem aufrüttelnden, aufwühlenden Film seine außergewöhnliche, irritierende Struktur. Im Wechsel mit den Schauplätzen des nationalen Armageddons führt die Reiseroute durch menschenleere Paradiese, lauschige Gehölze, bunte Blumenwiesen voller Vogelgezwitscher. In einem verfallenen Sportstadion, das als Flüchtlingslager dient, gehts fröhlich zu wie in einem wuselnden Feriencamp, und in der „twilight zone“ einer idyllischen Gartenstadt herrscht gar tiefer Frieden – fauler Frieden: Hier „hält man sich raus“, solange mans noch kann. In nächtlicher Natur glüht fern ein in Flammen stehender Fluss, und wie Sternschnuppen funkeln die millionenfach fliegenden Funken eines brennenden Waldes: in Höllenbildern die Poesie der Apokalypse.
Die Energie der Ehrlichkeit
- Im Kino: Anatomie eines Falls (Frankreich, 2023, Regie: Justine Triet, 151 Minuten)
Von Michael Thumser
20. März – Wer den deutschen Titel des französischen Gerichtsfilm liest, sitzt zunächst unweigerlich einem Irrtum auf. „Anatomie eines Falls“ – das erweckt den Eindruck, als würde wie in einem Thriller des Courtroom drama-Genres ein Verbrechen, seine Aufklärung und Aburteilung seziert. Fremdsprachig bewanderten Kinobesucherinnen und -besuchern indes erschließt sich die wahre Bedeutung, sobald auf der Leinwand der Originaltitel aufscheint: „Anatomie d’une chute“. Regisseurin Justine Triet zerlegt und studiert die Ursachen, Hintergründe und Folgen eines Sturzes, und selbst dieses Wort will vieldeutig verstanden sein. Was ist gemeint: ein Schwanken, Straucheln, Fallen? Oder Nieder- und Untergang, Verhängnis und Ruin? Die Wahrheit ist, das alles zutrifft.
Gefallen ist Samuel Theis (Samuel Maleski), abgestürzt vom zweiten Stock eines alten, von Welt und Menschen abgeschiedenen Bergbauernhauses in den tief winterlichen Alpen nahe Grenoble. Eine Dauerbaustelle: Zu einem Schutzraum kreativer Ruhe mit Zimmern für zahlende Feriengäste hat er das Anwesen ausbauen wollen. Nun liegt er tot im Schnee und in seinem Blut. Daniel, der elfjährige, seit einem Autounfall halbblinde Sohn (Milo Machado Graner), seinen Hund Snoop ausführend, stolpert über ihn. An Ort und Stelle ermittelt ein Kriminalistenteam, beschaut jeden Quadratzentimeter und bohrt insistierend bei Samuels deutscher Frau Sandra Voyter und Daniel nach. Im Jahr darauf muss sich Sandra, vom befreundeten Anwalt Vincent unterstützt, vor einem Schwurgericht verantworten. Scharf wie ein Bluthund will der Staatsanwalt der erfolgreichen Autorin autofiktionaler Romane nachweisen, Samuel erschlagen und von der Brüstung des Hauses gestürzt zu haben, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Begierig verfolgen das Publikum im proppenvollen Saal und die Medien die Obduktion am Kadaver einer im Grunde liebevollen Ehe, der Teamfähigkeit und Harmonie irgendwann verloren gingen.
In dem Prozess, sagt Vincent, der seit Langem verliebte Anwalt (Swann Arlaud), gehe es „nicht um die Wahrheit“, sondern darum, wie Sandra als Beschuldigte mit ihrer Version der Wahrheit wahrgenommen werde von den Menschen, die am Ende über Schuld oder Unschuld und ihr Schicksal zu urteilen hätten. Ganz anders sieht das Sandra selbst: „Es vermischen sich Wahrheit und Fiktion“, sagt sie schon ganz am Anfang, „und da will man natürlich herausfinden: Was ist wahr?“ Gute Frage. Wahr ist, hier wie meistens, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Der Film stellt während zweieinhalb unvermindert spannender Stunden die Frage: Wessen Wahrheit ist richtiger als die der anderen?
„Stark bleiben“
Auf die Wahrheit baut Sandra, um jeden Preis: „Alles offenlegen und dabei stark bleiben.“ Kunstreich und schwer durchschaubar bricht die sensationelle Sandra Hüller die Hauptfigur zwischen Ichsucht und Liebe auf, mit einer geradezu kindergläubigen Ergebung in den melancholischen Zügen; vor den Schranken des Gerichts strahlt ihre Offenheit eine gespenstische Ruhe aus. Überhaupt fügte Regisseurin Triet – in unerschütterlichem Einverständnis mit Kameramann Simon Beaufils und Cutter Laurent Sénéchal – die filmische Erzählung weitgehend aus langen, akribisch beobachtenden Nahaufnahmen von Gesichtern zusammen, wobei das der Protagonistin von den ersten Einstellungen an als Hauptakteur fungiert. Mit dem momentgenauen Wechsel feinster Regungen in Augen und Stirn legt Hüllers Haut jede offensichtliche und erst recht jede subkutane Nuance von Sandras Innenleben dar; einmal zeigt die Leinwand gar nur ihre Lippen: Sprechen als Mienenspiel. Bei den Festspielen in Cannes, deren Jury den Film mit der Goldenen Palme prämiierte, nahm die Künstlerin hochverdient den Preis für die beste Hauptdarstellerin entgegen.
Noch weit intensiver und detailreicher als in Jonathan Glazers „The Zone of Interest“ (siehe den Beitrag unten: Paradies der Perversion) dringt Hüller in ihre Figur ein. Unter ihrem geistvollen und charmanten Äußeren, in ihrer unerbittlichen Argumentationskraft offenbart sie die Tiefe und Doppelgesichtigkeit einer Frau zwischen der Autonomie als erfolgreiche Künstlerin und der Hingabe an Mann und Kind, zwischen berechtigtem Egoismus und kameradschaftlicher Uneigennützkeit. Auf dem Höhepunkt des Dramas, einer Rückblende mit packender Klimax, wirft Samuel ihr vor, von ihr „bestohlen und betrogen“ worden zu sein, habe Sandra doch ihre Kreativität auf Kosten der seinen durchgesetzt. Scharfsinnig hält sie dagegen: „Auf der Suche nach Selbstbewusstsein“ flüchte er in eine Opferrolle, um seinem Scheitern als Hochschuldozent und Schriftsteller, auch um seiner eingebildeten Verantwortung für die Behinderung Daniels zu entkommen. Von der „Energie der Verzweiflung“ spricht Sandra: „Manchmal ist ein Paar ein einziges Chaos.“
Fall und Verfall
Aber als Paar, von gegenseitiger „intellektueller Stimulation“ zusammengehalten, blieben sie und Samuel beieinander bis zum bitteren Ende, „nicht immer einig, aber wir hatten uns was zu sagen“. Alles offenlegen, stark bleiben: Sandra Voyters Energie verdankt sich nicht der Kaltblütigkeit einer Mörderin, sondern ihrer Ehrlichkeit, bei Sandra Hüller der Wahrhaftigkeit unter einer äußerlichen, sie panzernden Kühle, durch die sie die Trauer um Samuels physischen Fall und seinen seelischen Verfall, auch um ihr eigenes Scheitern in der moribunden Beziehung verbirgt. Unbeirrbar bleibt sie so, über alle Verzweiflung und über die Entscheidung des Gerichts hinaus.
Dem schallt die geräuschvollste Auseinandersetzung von einer Tonaufnahme entgegen, aufgezeichnet auf einem Datenstick: Nicht zuzuordnende Schläge klatschen, Gläser klirren, Möbel krachen, Stimmen stöhnen – eine Eskalation, deren lärmende Gewaltsamkeit unsichtbar bleibt, weil der – bis in die Nebenrollen, einschließlich Snoops, des Hundes, ungemein gewieft besetzte – Film die Bilder ausgerechnet hierfür raffiniert verweigert. „Was ist wahr?“ In jedem Ermittlungsergebnis, jeder Aussage, jedem Vorwurf, sagt Sandra, zeige sich stets nur „ein Teil der Situation“. Die aber, die ganze Wahrheit, ist mehr als die Summe ihrer Teile.
Paradies der Perversion
- Im Kino: The Zone of Interest, (USA, Großbritannien, Polen, 2023, Regie: Jonathan Glazer, 106 Minuten)
Von Michael Thumser
16. März – Als ob es für einen solchen Stoff Bilder gar nicht geben könnte, verweigert der Film sie den Zuschauenden zu Beginn minutenlang. Nur dunkles Graublau zeigt die Leinwand, dazu ertönt eine Art dräuenden Requiems, das die britische Musikerin Mica Levi halb aus finsterem Chorgesang, halb aus suggestiv-dunklen Geräuschen komponierte. Doch dann, als Licht ins Spiel kommt: heller Sommer; heitere Badesee-Idylle; während der Heimkehr durch eine abendlich verdämmernde Natur Kindergeplapper von den Rücksitzen einer Limousine mit SS-Runen auf dem Nummernschild.
Zurück führt der Weg in ein Paradies, das seinen Platz gleich bei der Hölle hat. Mögen sich Leben und Tod sonst durch eine unsichtbare Linie voneinander trennen – hier, in Auschwitz, erhebt sich eine hohe Wand zwischen dem sorgsam eingehegten Diesseits der Familie Höß und dem unmittelbar benachbarten Jenseits des Konzentrationslagers. Ausschnitte aus absurder Gewöhnlichkeit reihen sich aneinander: Geburtstagsglückwünsche für den stramm uniformierten Papa, die aufgeregte Liebe eines nibelungentreuen Hundes, flutender Sonnenschein im Blumengarten mit Aussicht auf Mauer und Stacheldraht, Wachturm und qualmende Schlöte.
Weil sich das Grauen der Todesfabrik einer authentischen Wiedergabe durch fiktive Bilder schlechterdings entzieht, unterließ es Jonathan Glazer, welche zu entwerfen. Jener Verzicht ist der eigentliche Stoff des (auf Motiven eines Romans von Martin Amis fußenden) Films, dem alles fehlt, was üblicherweise als Handlung gelten könnte. Vielmehr vollzieht der britische Regisseur nüchtern beobachtend und unverstellt zeigend nach, wie Lagerkommandant Rudolf Höß, seine Frau Hedwig und die mustergültig abgerichtete Kinderschar in blitzblanker Gutbürgerlichkeit bei gehobenem Wohlstand ihr Haus und Grundstück bewohnen, von dem aus Tag für Tag das Zerstörungswerk einer gigantischen Menschenmühle zu hören ist. Zu hören, nicht zu sehen: Dafür hat der findige Sounddesigner Johnnie Burn eine extrem elaborierte Tonspur hergestellt, die Vogelgezwitscher und Gewehrschüsse, Waldesrauschen und Kommandogebell zu einer perversen Polyphonie verwebt. Beim Ausritt durch wild wucherndes Grün belauschen Vater und Sohn eine Rohrdommel, soweit das Schreien der SS-Schergen und der gemarterten Gefangenen nicht deren dumpfe Laute übertönt. Untrennbar fließen Heimeligkeit und Horror ineinander.
Radikale Distanz
Von beidem vermittelt der erstaunliche Film Wahrnehmungen der eindrücklichsten, abstoßendsten, bestürzendsten Art und hält gleichwohl beim einen wie beim andern radikal Distanz. Als die SS den treusorgenden, nur ein bisschen untreuen Familienvater für einen Winter nach Oranienburg zu einer Inspektionsbehörde abkommandiert, nimmt er den tadelfrei glatten Lauf seines Büro- und Konferenzalltags dorthin mit. In Auschwitz hat er in honoriger Herrenrunde mit Abgesandten der Erfurter Firma Topf & Söhne die Pläne für ein innovatives, patentwürdiges Krematorium erörtert und gebilligt, das Ermordete noch effizienter als bislang atomisiert, „Ladung“ für „Ladung“, im „Dauerbetrieb“. Nun, am neuen Dienstsitz, geht er mit den versammelten Lagerkommandanten in zweckgerichteter Sachlichkeit die anstehende „Vernichtung“ von siebenhunderttausend ungarischen Juden durch. In der gespenstisch doppelbödigen Rolle des gewissenlosen Planers unterläuft Christian Friedel subtil die milchkindbleiche Anmutung des schüchternen Weichlings mit der grotesken Haartracht: Unter der Knabenhaut funktioniert diensteifrig ein karrieristischer Vollstrecker, der kein Wenn, kein Aber kennt. „Aktion Höß“ heißt das Unternehmen im massenmörderischen Nazijargon: Kein anderer als er, das weiß sein Dienstherr Heinrich Himmler, bringt die Erfahrung, die Routine und den Mumm mit, ein solches Projekt ins befohlene Ziel zu führen.
Scheinbar völlig unanstößig sehen die Szenen und Sequenzen in ihrer Einfachheit und dem Einerlei ‚typisch deutschen‘ Gleichmaßes aus, sodass schnell klar wird, wie entschieden der britische Regisseur und sein polnischer Kameramann Łukasz Żal jede plakative Wirkung zu vermeiden trachteten. Schockmomente ergeben sich mittelbar: etwa wenn stolz erhoben der Kopf des Kommandanten, von Rußflocken umflattert, vor bedecktem Himmel über dem wüsten Gewirr aus den Stimmen eines eben eingetroffenen Häftlingstransports auftaucht; oder einmal beim Baden im Flüsschen neben Haus und Lager, als Höß, vor einer heranschwimmenden Ascheschicht weichend, unversehens einen Knochen aus dem Wasser fischt; oder im glutroten Flammenschein, den die Krematoriumskamine durch die Nacht in die Schlafzimmer der unbeeindruckt schlummernden Familie werfen – und vor dem die zu Besuch weilende Mutter der Hausfrau, vorzeitig abreisend, entflieht.
Diabolische Normalität
Heim und Garten: auch dies ein Lager der Konzentration. Hier fasst Hedwig Höß ihre herrschsüchtig wirkenden Kräfte straff zusammen: Sandra Hüller, großartige als Kommandantin, die ihre Kinder und das furchtsam verstummte Dienstpersonal wie ein Feldwebel drillt und ihr Freiluftgehege in aller teutonischen Gründlichkeit zum Mustergütchen ausstaffiert. Nach Oranienburg folgt sie dem Gatten nicht, mit der Wachheit ihres unwidersprechlichen Willens nimmt sie für das klinisch saubere Zuhause und ihren „Paradiesgarten“ neben der Hölle die Trennung in Kauf. Die Kälte diabolischer Normalität verbreitet die Schauspielerin um sich, im Vollbesitz eines angemaßten Anspruchs verteilt sie als Gebieterin herablassend Damenwäsche aus den geplünderten Koffern der Inhaftierten unter den Hausangestellten und behält einen schweren Pelzmantel, ihn mit Kennerschaft probierend, in grausiger Selbstverständlichkeit für sich.
Gerade indem der Film durch absichtsvolle Langsamkeit, durch das akkurate Arrangement seiner ausführlichen Einstellungen und gemächlichen Fahrten alle Aufgeregtheit vermeidet, verschließt er jeden Ausweg ins Aufatmen einer hoffnungsvollen Beruhigung. Eine realistische Gegensphäre zur Welt unmenschlicher Widersprüchlichkeit lässt er nicht zu und öffnet sich der Humanität lediglich in einer nächtlichen Reihe unwirklich verfremdeter Zwischenepisoden: Dann hastet in weiß-schwarzen Negativbildern ein polnisches Mädchen zu den Zwangsarbeitsplätzen der Häftlingskolonnen, um dort heimlich Äpfel für sie zu verstecken – zumindest äußerlich die dramatischsten Momente eines cineastischen Meisterwerks, das in der bitteren Eigenwilligkeit seiner konsequenten Contenance Vergleichbares nicht kennt. Jeder Spannungs- und Konfliktdramaturgie, sogar jeder konventionellen Fabel versagt es sich, weil seine Schöpfer wissen, dass sich nicht gültig und verbürgt von etwas erzählen lässt, das unsäglich und unsagbar ist.
■ Das Hofer Central-Kino (Altstadt) zeigt im Rahmen seiner „Oscar-Woche“ auch den französischen Justizthriller „Anatomie eines Falls“ von Regisseurin Justine Triet, ebenfalls mit Sandra Hüller in einer Hauptrolle.
Der auf dem Wurm reitet
- Im Kino: Dune, Part two (USA, 2024, Regie: Denis Villeneuve, 166 Minuten)
Von Michael Thumser
2. März – Im Glas sieht das „Wasser des Lebens“ aus wie Blue Curaçao. Doch dieser Cocktail hat es in sich: Ein Schluck genügt, und Paul Atreides, nachdem er die tödlichen Wirkungen des Gifts erst einmal lebend überstanden hat, sieht fortan gleichsam in allen Richtungen durch die Zeit. In ganzer Tiefe offenbaren sich ihm nun die Vergangenheit seiner Herkunft und seine Rolle in der Gegenwart, namentlich aber vermag er in die Zukunft zu blicken. Und er begreift: Falls er sich zu der Mission bekennt, die ihm das unterdrückte Volk der Fremen inständig anträgt, falls er akzeptiert, ihnen als Messias voranzugehen, dann muss er sie in den „heiligen Krieg“ gegen die Harkonnen führen. Und der wird Abermillionen von Todesopfern fordern. Das lockt ihn wenig.
„Macht über Spice ist Macht über alles“, raunt ganz zu Beginn, noch bei nachtschwarzer Leinwand, eine nachtschwarze Stimme in fremder Sprache. Zum Glück ist der Satz untertitelt. Denn er gibt das Leitmotiv ab für „Dune, Part two“, mit dem Denis Villeneuve den spektakulären Auftakt seines Science-Fiction-Epos von 2021 nicht minder spektakulär fortsetzt. Dune, Düne, nennen die Fremen (free men, freie Menschen) ihren kochenden, mithin kaum bewohnbaren Wüstenplaneten Arrakis. Das Spice, das auf ihm – und exklusiv im Weltall nur auf ihm – abgebaut wird, hat nichts mit dem gleichnamigen, preiswerten Rasierwasser von heute zu tun, sondern ist im Jahr 10191 ein unbezahlbares „Gewürz“ der daseinsverändernden Art: Bei bedarfsgerechter Einnahme verlängert es das Leben und verleiht weitreichende Hellsicht, zielsichere Orientierung bei Fernreisen durchs All sowie obendrein blaue Augen. An der raren Droge wie an einem Kondensator entzünden sich die kosmischen Konflikte, die zwischen den Galaxien und ihren „großen Häusern“, der aufrechten Fürstenfamilie Atreides, dem – nur scheinbar allesbeherrschenden – Imperator (Christopher Walken) und den vollständig moralbefreiten Finsterlingen um den Baron Harkonnen nebst sadistischem Neffen (Stellan Skarsgård, Austin Butler) mit der Gewalt kleinerer Supernovae entbrennen.
Ins Unermessliche
Kann Kino einen Wüstenkrieg entfesseln, ohne, auch nach über sechzig Jahren, an David Leans „Lawrence von Arabien“ anzuknüpfen? Tatsächlich kämpfen in „Dune“ gleichfalls Wüstensöhne in Kaftanen, die Köpfe tuchumwickelt, mit fanatischer Tapferkeit und sind gerade mal mit Kurzschwertern und Dolchen gerüstet – gegen weit gewalttätigere Schuss- und geradezu apokalyptische Sprengwaffen. Gleichzeitig freilich entwerfen die von Hans Zimmers Kolossalmusik und einem hypnotisch-grundstürzenden sound design illustrierten Panoramen (Kamera: Greig Fraser) Überwältigungsanblicke von gigantischen Flugschiffen und endlos sich dehnenden Außen- und Innenräumen. Visuell und inhaltlich finden Inspirationen aus dem ritterlichen Mittelalter, den frühen Hochkulturen Mesopotamiens und „Tausendundeiner Nacht“ zusammen mit futuristischen Highest-Tech-Fantasien im Gefolge der „Star Wars“-Serie. Vegetationslos-stahlglatte Architekturen, ominöse Maschinen und surrende Mechaniken gemahnen an Fritz Langs „Metropolis“ von 1927, eine turmhohe Kampfarena, unter erschreckend „schwarzer Sonne“ von einer millionenköpfig wimmelnden Fanschar auf Tribünen umstanden und umschrien, projiziert Ridley Scotts „Gladiator“ ins Unermessliche.
Um bei „Dune: Part two“ folgen zu können, sollte man sich vor dem Besuch noch einmal mit „Dune: Part one“ vertraut machen; während der drei Jahre seit seinem Kinostart ging selbst starken Gedächtnissen so manche Verästelung des Stoffs, der eine oder andere unerlässliche Begriff aus der komplexen Romanwelt Frank Herberts und ihrer Verfilmung verloren. Doch auch wer unvorbereitet zusieht, fühlt sich schnell und von Szene zu Szene mehr an die Überlieferungen von Weltreligionen und zeitlosen Welterzählungen erinnert. Unverhohlen setzen Regisseur, Autoren, Bildgestalter auf die Geltung des Spirituellen, des Fremden und Befremdlichen, des Rätselhaften und Unheimlichen. Indem die Episoden und Sequenzen meist vereinzelt für sich stehen, lockert und löst sich die dramaturgische Konsistenz. Zahlreich springt die Handlung von einem Strang zum andern, vielfältig wechseln die intimen oder überdimensionalen, anmutigen oder furchterregenden Schauplätze. Wütend legen Kampf- und Schlachtenszenen den Grund für den Rhythmus. „Nichts ist deutlich, es sind nur Bruchstücke“, so wie Paul Atreides’ visionäre Albträume, die den Geschehnisgang zusätzlich demontieren und ins Magische transzendieren. Das Aufgebrochene, Undurchsichtige mag manchen Betrachter verstören, die Wirkkraft des Films zerstört es nicht, im Gegenteil: Als ein Haupt-Reiz setzt es sich durch, weil, mit beträchtlicher Sogkraft, das Mysteriöse auf das Mythische verweist.
Blaue Träume
Und das spielt auf Buddhismus, Hinduismus, Islam so bedenkenlos an wie aufs Christentum. Zum „Lisan al-Gaib“, zum Religions- und Revolutionsführer der Fremen, sieht sich Paul – Tomothée Chalamet – ausersehen, weicht aber, wie der Jesus des Evangeliums, aus „Angst vor Anbetung“ der überfordernden Berufung aus. Mit den Kampfnamen „Usul“ – Fundament der Säule – und „Muad’Dib“ – Der den Weg weist – ehren die Fremen ihn ehrfürchtig für seine Tapferkeit, und wirklich vollbringt er schier Unglaubliches: Auf einem Sandwurm, einem Hunderte Meter langen, wahllos alles verschlingenden Ungetüm mit lanzenbewehrtem Monumentalmaul, wagt er, der Himmlische, einen Höllenritt durch brandende Sandwogen und tosenden Sturm. Dagegen sah Jesus, als er brav auf dem Wasser wandelte, wohl wie ein Anfänger aus.
Auch für blaue Blumenträume der Romantik ist Hoffnung und Platz. Mit der zierlichen, aber unbesiegbar dreinschlagenden Kriegerin Chani – Beiname: „Frühling in der Wüste“ (Zendaya) – findet die Lichtgestalt zu zarter Liebe. Ob die beiden eine gemeinsame Zukunft haben? „Es ist noch nicht vorbei“, sagt Chani, und das gilt, nach fast drei Filmstunden, für das „Dune“-Epos auch. Part three, mindestens, scheint unausweichlich. Bis er in die Kinos kommt, können sich ungeduldig Wartende, wenn schon nicht mit blau machendem Spice, so doch mit Blue Curaçao behelfen oder mit handelsüblichem „Wasser des Lebens“ sedieren, wörtlich übersetzt: mit Aquavit.
Das Gegenteil von allem
- Im Kino: Eine Million Minuten (Deutschland, 2024, Regie: Christopher Doll, 125 Minuten)
Von Michael Thumser
23. Februar – „Vier Minuten“, wie in Chris Kraus’ Hofer Filmtage-Sensationserfolg von 2006, sind viel zu wenig. „15 Jahre“ – so der Titel seiner beim jüngsten Festival uraufgeführten Fortsetzung – wären des Guten zu viel. Aber „Eine Million Minuten“, die wollen Wolf und Vera sich als Auszeit gönnen: 695,5 Tage, nicht viel weniger als zwei Jahre Freiheit in Gemeinsamkeit.
In rundum abgesichertem Berliner Wohlstand leben das junge Paar und seine kleinen Kinder, aber so richtig zusammen sind sie nicht. Wolf, mehr im Flugzeug und in der Welt unterwegs als daheim bei den Seinen, arbeitet bei den Vereinten Nationen pausenlos gegen den Frust an, nie genug tun zu können für die bedrohte Artenvielfalt, das Klima, für weltweit faire Arbeitsbedingungen. Da bleiben Haushalt, Brut- und Beziehungspflege an Vera hängen. „Ich bin so nicht glücklich“: Die Care-Arbeit würde sie sich lieber mit dem Partner teilen, um selbst wieder in ihrem Beruf arbeiten zu können.
Blüte der Fantasie
Zumal Töchterchen Nina, einer therapiebedürftigen Entwicklungsstörung wegen, Sorgen macht. Ein Problemkind ist die Fünfjährige darum nicht – im Gegenteil. Als Sonnenschein der Familie spürt sie sehr genau den Druck, der die Eltern niederbeugt, und bringt als Blüte ihrer Fantasie die rettende Idee ans trübe Licht: „Eine Million Minuten nur für die ganz, ganz schönen Sachen“ – das würde allen guttun. Und weil das Wünschen im Regiedebüt des Filmproduzenten Christopher Doll (und in Wolf Küpers Bestsellervorlage von 2016) hilft, dürfen sich die vier davonmachen, nach Thailand erst, sodann nach Island. Dort lernen sie, mit den digitalen Hilfsmitteln des Homeoffice zwischen work und life zu balancieren – und sie begreifen, dass weder das Zuhause noch ein Woanders, sondern das Beieinandersein Heim und Heimat bietet. „Es geht um Zeit, zusammen, für Nina.“ Happy End. Ein Wohlfühlfilm. Aber auch ein bisschen mehr.
Wolf ist gewohnt, den Planeten als Ganzes zu beobachten; die Linie dafür gibt seine Chefin kategorisch vor: „Wir müssen das Gegenteil von dem tun, was wir die letzten dreißig Jahre über getan haben.“ Bevor seine und Veras liebevolle, aber bedrohte Partnerschaft unheilbar Schaden nimmt, tun die beiden „das Gegenteil“ von allem, was sie bisher taten. Sie breiten ihr privates Dasein über den Planeten aus, indem sie ihr Glück an zwei Küsten suchen, im bunten, scheinbar ewigen Urlaubssonnensommer eines fernöstlichen Traumstrandes, im kalten Karst am grauen Nordatlantik knapp unterm Polarkreis. In Andreas Bergers wohlkomponierter Bildästhetik offenbaren beide Lebensräume eine vielsagende Gegensätzlich- und Zwiespältigkeit. Denn Ferne allein taugt noch nicht als Startpunkt für einen Neuanfang, und bloß durch Rollentausch – schließlich besorgt Wolf den Haushalt, während sich Vera als gelernte Bauingenieurin bewährt – stellt sich Geschlechtergerechtigkeit nicht her.
Zeit der Zähne
Indem der Regisseur und das fünfköpfige Drehbuchteam die Geschichte des Paares erzählen, erzählen sie vor allem Wolfs Geschichte. Durch Einsicht und Selbstüberwindung durchläuft er eine existenzielle Wandlung, die leicht zum Stoff einer trivialen Moralpredigt verkommen könnte, drückte nicht der fabelhafte Tom Schilling sie durch die Schwankungen seiner - noch fast jugendlichen - Aufbruchsbereitschaft, durch oft feine Nuance der Mimik unverfälscht aus. Wieder zeigt sich, dass der 42-jährige Künstler sich unter die authentischsten Charakterdarsteller im Lande rechnen darf. Ungeachtet solcher dramaturgischen Dominanz gelingt es der subtil leidensfähigen, kompromissbereit selbstbewussten Karolin Herfurth, als Vera unwidersprechliche Durchsetzungskraft aufzubauen und sich zu bewahren. Sympathischerweise erlaubt die Schauspielerin - und Ehefrau des Regisseurs - der kleinen Pola Friedrichs, ihr mit Ninas erhellend schräger Sicht auf die Welt und ihren pausbäckigen Sentenzen zwischendurch den Rang abzulaufen.
Am Wachstum ihrer Milchzähne, nicht an Himmel, Wind und Wetter lässt sich die Zeit und Jahreszeit ablesen, um die „es geht“: an den sich allmählich schließenden Lücken in Ninas witzig-vorwitzigem Mund. Dass es Zeit für kein Geld der Welt zu kaufen gibt – so wenig wie die Nähe der Liebe –, nicht für Bienenfleiß, Integrität und Engagement, nicht für ein in der Mühle der Termine aufgeriebenes Dasein, das baut sich als Grundproblem vor Millionen Menschen auf. Stimmt schon, die Protagonisten in Christopher Dolls Film leisten sich eine kostspielige, geradezu traumhafte Luxuslösung, wie sie in der bundesdeutschen Wirklichkeit selbst gutsituierten und cleveren Zeitgenossen aus dem oberen Mittelstand wohl kaum je zu Gebote steht. Freilich lässt sich die unterhaltsame, von einem exquisiten Ensemble getragene Aussteigermär auch als Planspiel anschauen (Was wäre, wenn …?), als realistische Modellsituation mit radikal utopischer Klärung. Für dergleichen war Kino noch immer gut, und selten zu seinem Schaden.
Das Asthma der Geschichte
- Im Kino: Napoleon (USA/Großbritannien, 2023, Regie: Ridley Scott, 158 Minuten)
Von Michael Thumser
7. Dezember – Am Ende seiner Tage konnte er nichts von dem Wenigen, das er noch aß, bei sich behalten. Bevor er am 5. Mai 1821 den Geist aufgab, hatte Napoleon Bonaparte, erst 51 Jahre alt, mit verkrebstem Magen seine letzten Wochen im Bett zugebracht, so geschwächt, dass er selbst bei den wenigen Metern zum „Nachtstuhl“, der Toilette, gestützt werden musste.
Am Ende des Films ist er anders beieinander. Da sitzt der gestürzte Imperator auf St. Helena im Garten von Longwood House, seinem zweiten und letzten, reichlich schäbigen Exil, und scherzt mit zwei halbwüchsigen Mädchen, die er mit Trauben bewirft. Dann, als schattenhafte Rückenfigur mit dem unverkennbaren Zweispitz auf dem ehrgeizigen Haupt, kippt er schmerz- und lautlos nach links zur Seite. Monate der Resignation und der sich verschlimmernden Krankheit erspart Starregisseur Ridley Scott seinem historischen Helden.
Der hier gar keiner ist: kein Held. Nicht als geringster Vorzug von „Napoleon“ kann gelten, dass dieser große Film, wenn er schon nicht getreu den Fakten der Geschichte folgt, vor allem keine Geschichte vorbildlichen Wagemuts und triumphierender Tapferkeit ausbreitet, nicht die Legende eines „großen Einzelnen“ – wie man seinesgleichen früher einmal nannte –, der sich genial den Weltlauf unterwirft. Bevor der Protagonist zu Beginn, im Dezember 1793 und also vier Jahre nach Ausbruch der grande révolution française, den von einheimischen Royalisten und britischen Seestreitkräften besetzten Hafen von Toulon erobert, ist sein eingefrorenes Gesicht zu sehen, mit einem sich selbst wie betend Kraft zumurmelnden, schwer atmenden Mund. Nicht der Atem der Geschichte, ihr Asthma macht sich so bemerkbar. Angst hat Napoleon, sogar er, im Film die einzige wirklich menschliche Regung des selbst ernannten Kriegsgotts. Er wird sich während der gut zweieinhalb Kinostunden dieses vermeintlichen Heldenlebens nicht völlig von ihr befreien.
Entsetzliches Scheitern
Die eisstarre Mimik leiht Joaquin Phoenix dem Feldherrn aus Ajaccio – einem, der niemals jung gewesen ist. Die verbissen wie zur Faust geballten Züge des gerade mal 24-jährigen Siegers von Toulon und frisch gekürten Brigadegenerals sehen schon beinah so maskenhaft farblos aus wie die des Sterbenden von St. Helena. Für Napoleons Wirken als Verwaltungsreformer und Gesetzgeber des code civil interessiert Ridley Scott sich nicht, er lässt, was an Verdiensten sich benennen ließe, unerwähnt. Ausschließlich den notorischen Krieger und Kriegsherrn führt er vor, der weite Teile Europas durch die Eisenhärte seines Willens bezwingt und dem die Lust auf ausufernde Macht alle Lustigkeit ausgetrieben hat. Als „Retter“ jener Republik, die ein Königspaar hat köpfen lassen, um Bestand zu haben, lässt er sich feiern – um sich sodann selbst zum Kaiser zu krönen. Im menschenleeren Moskau, dem Ziel seines ehrgeizigsten, entsetzlich gescheiterten Feldzugs, nimmt er auf dem verwaisten Zarenthron des Kremls Platz und figuriert doch in keinem filmischen Moment so wenig wie in diesem als der Universalherrscher, der er aus eigenen Gnaden zu werden trachtete.
Die Produktion mutet weit stärker wie ein europäischer Film an als wie ein ‚typisch‘ amerikanischer. Dennoch hat, nicht zuletzt vonseiten akademischer Historiker, Scotts in mancherlei Hinsicht unkonventionelles Biopic reichlich Widerspruch erfahren: Diese Einzelheit, jener Umstand stimmten nicht überein mit der gründlich erforschten Faktenlage. Ein wohlfeiler Vorwurf: Seriöses Geschichtskino erfüllt seine Aufgabe nicht erst, wenn es einen Volkshochschulvortrag oder ein Telekolleg ersetzt, sondern darf sich die Freiheit der Fiktion erlauben, um seine Stoffe zu erfinden. Eben dies nimmt Regisseur Scott sich heraus. Statt in einem effektvoll bunten Kriegsepos von einem opulenten Schlachtengemälde zum nächsten zu eilen, entwirft er unverhohlen ein subjektiv einseitiges, darum nicht weniger bedenkenswertes Porträt des Vermessenen. Kühl fügt er charakterisierende Episoden aneinander, wobei er sich einer genreüblichen US-Dramaturgie von sich überbietenden Spannungskurven mitsamt dem Pathos unerschrockener Mannhaftigkeit und waghalsiger Bewährungsproben verweigert.
Frostklirrende Massaker
Nicht erst mit den horrenden Opferzahlen auf Texttafeln vor dem Abspann macht Scott dem Heerführer die Rechnung eines massenhaften Menschenverbrauchs auf: Die Wahl-, Wehr- und Gesichtslosigkeit, mit der Scharen von Soldaten dem Gutdünken des Schlachtenlenkers ausgeliefert sind, zeigt sich ausdrücklich glanzlos in ihrem aberhundert- und -tausendfachen Krepieren während der Gefechte. Noch grauenvoller als das finale Gemetzel von Waterloo, das im Juni 1815 die „Hundert Tage“ des aus der ersten Verbannung nach Elba zurückgekehrten Wiedergängers abschloss, gelingen dem Regisseur zuvor die frostklirrenden Schilderungen der Massaker von Austerlitz und Borodino: buchstäblich Blutbäder in Grauweiß, Eisblau, Rot. Mit den reduzierten Mitteln des Kriegskinos bläht er den Typus des Warlords zur abstoßend-furchterregenden Schreckgestalt mit Überreichweite auf. Ein Menschenleben oder zehn gelten ihm so wenig wie die 560.000, die während seines Russlandfeldzugs von 1812 in der Grande Armée zugrunde gingen. Noch während der Überfahrt in sein zweites, letztes, atlantisches Exil spricht er sich selbst frei von allem persönlichen Versagen und Kriegsverbrechertum.
Weit über zeitliche Klüfte und räumliche Entfernungen hinweg spannt der Film die Ereigniskette zwischen Aufstieg und Untergang. Als Kontinuum hält die süchtige Liebe zwischen Napoleon und Joséphine de Beauharnais die Stationen zusammen: zwei, die weder mit- noch ohneeinander auskommen. An der Seite der aristokratisch sozialisierten, geistvoll koketten femme fatale mit ihrer mondänen Eleganz offenbart der zu historischer ‚Größe‘ sich emporkämpfende Popanz einen eklatanten Mangel an Weltläufigkeit. Im Herzen ein Prolet, muss er sich von seinen Gegnern als „korsischer Rüpel“ schmähen lassen. Den Charismatiker Napoleon spielt Joaquin Phoenix, ohne sich zu schonen, als Kotzbrocken. Nicht einmal vor den kaninchenartig fixen Kopulationen mit seiner Kaiserin schält er sich aus der Uniform, in die er sich bis zur Bocksteifheit eines Monuments einknöpft. Gemäß dem speziellen Bild, das der Regisseur und sein Drehbuchautor David Scarpa von dem Usurpator entwerfen, sieht sich der – vielfach erstklassig erprobte – Darsteller schlichtweg zum Verzicht auf Schauspielerei angehalten; hingegen lässt Vanessa Kirby als Joséphine, unter einer resilienten Oberfläche von Schicklichkeit, mittels hauchfeiner Nuancen das Glühen einer unauslöschlichen Leidenschaft spüren.
Was Ridley Scotts Film, neben vielem anderen, nicht berichtet: Napoleon kehrte fast zwanzig Jahre nach seinem Tod zum zweiten Mal nach Frankreich zurück, nun für immer, ins Pariser Hôtel des Invalides als letzter Ruhestätte. Dort, in der Krypta unter der goldenen Kuppel, verharrte am 28. Juni 1940 Adolf Hitler in stiller Ehrfurcht vor dem dreizehn Tonnen schweren Sarkophag aus rötlichem russischem Porphyr, um sich vom Atem der Geschichte anwehen zu lassen. Hätte der Franzose aus Korsika zu Lebzeiten einen deutschen Gast wie diesen, der seine Megalomanie überbot, willkommen geheißen? Der Tod hat sie einander gleich gemacht: Am Ende ihrer Tage gingen beide ähnlich elend vor die Hunde.
Variationen der Stille
- Im Kino: Ein ganzes Leben (Deutschland/Österreich 2023, Regie: Hans Steinbichler, 115 Minuten)
Von Michael Thumser
21. November – Wie die Menschen in diesem Hochtal der Alpen um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert leben, so haben ihre Vorfahren dort vor siebzig oder achtzig, zwei- oder dreihundert Jahren auch schon gelebt: ausschließlich von dem, was sie Wäldern und Feldern mit Körperkraft und Eifer abringen, gleichsam vorgeschichtlich ohne Segnungen und Risiken des Fortschritts, ohne wirksame Vorkehrungen gegen Unheil und Gefahr, keinen anderen Geboten gehorchend als denen, die ihnen die Religion gegeben hat und die sie selbst sich geben.
„Ein ganzes Leben“: Das des Bergbauernknechts Andreas Eggert, in Hans Steinbichlers Film, währt siebzig Jahre, und wenns hoch kommt, sinds achtzig Jahre, und immerfort ist es ist Mühe und Arbeit gewesen. Nichts in all der Zeit ändert sich am Grund dieser Existenz, mag sich auch darum herum alles ändern, tiefgreifend und unumkehrbar. Wandel allenthalben: Der Körper des Protagonisten (Stefan Gorski, als Greis: August Zirner) blüht auf, nimmt Schaden und verfällt, mit der Elektrizität, dem Wintertourismus und den Autobussen hält die Zivilisation unabweisbar Einzug zwischen den Schneegipfeln, die allein sich in stolzer Stille Unwandelbarkeit vorbehalten. Was die Buchvorlage, Robert Seethalers für seine lakonische Kürze und beredte Einfachheit gefeierter Roman von 2014, erzählt, das inszenieren der Regisseur und Armin Franzens einzigartig kreative Kamera ganz im selben Sinn, gleichwohl ganz autonom: entschieden cineastisch.
Das ungeschönte Schöne
Von der „Ewigkeit“ der Berge und ihrer Wälder sang und säuselte der eskapistische Heimatfilm der Fünfziger- und Sechzigerjahre reichlich. Grund genug für den Regisseur – der selbst ein sogenanntes Kind der Berge ist –, jede Analogie mit ihnen im Keim zu ersticken. Geradezu übervorsichtig umgeht er die sommerdurchsonnte Ansichtskartenmotivik, die romantisierende Zünftigkeit im Zwischenmenschlichen, das gekünstelt Urwüchsige der Ausdrucksweise von einst. In seinem Film ist das unleugbar Schöne ungeschönt: Keine Sehenswürdigkeiten geben die machtvollen – und eingestandenermaßen von Gemälden Caspar David Friedrichs inspirierten – Gebirgsaussichten und -rundblicke preis. Statt Idyllik offenbaren sie eine vielfach abweisende Rauheit und Härte. Vergleichbar eignet jedem Gesicht etwas zeit- und leidgeprüft Knorriges und Derbes.
Weil Andreas unehelich zur Welt kam, darf der verwaiste „Bankert“ in der dunklen Wohnstube des Bergbauern Kranzstocker nur abseits von der Familie, in einer noch dunkleren Ecke, sein Essen verzehren. Woher er hierher gekarrt worden ist, verrät der Film nicht; wohin er nach den sieben, acht Jahrzehnten seines Erdendaseins entschwinden wird, ist ihm, der „nie an Gott geglaubt“ hat, ganz gleich. Dazwischen ist er einfach da: gebunden an die Enge des Hofs, des Dorfes und der Umgegend, über die hinaus der Blick von den Bergflanken und -gipfeln aus in ein unerreichbar Unendliches führt.
Schutzlos wächst der duldsam willfährige Junge in einem menschenrechtsfreien Raum heran, ausgeliefert den Misshandlungen des aus Schwermut sadistischen Pflegevaters (grandios abstoßend: Andreas Lust) und seiner hasserfüllten Ausbeuterei. Wie unter einer Hornhaut sich abhärtend, gedeiht Andreas durch Knochenarbeit baumstark zum Kraftkerl. In gesuchter Einsamkeit wirtschaftet er für sich; dann gewinnt er die schlicht-empathische Marie (Julia Franz Richter) zur Gefährtin und findet sein Glück in ihr, bis er es an die Gewalten der Natur zurückgeben muss. Halsbrecherisch verdingt er sich beim Seilbahnbau und arbeitet insofern der metastasierenden Zivilisation zu, ohne dass die ihn je etwas angeht … In die Stille seiner Innen- und die engen Grenzen seiner Außenwelt verkapselt er sich beharrlich, sogar noch, als der Zweite Weltkrieg ihn als Wehrmachtssoldaten weit weg an die Ostfront verschlägt: Auf den Kaukasus schaut er, als wärs die Bergwelt daheim; „nur“, schreibt er in einem seiner ungeschliffen poetischen Briefe an die tote Marie, „die russische Kälte ist anders“.
Die Zeit dazwischen
Mit dem einsilbigen Andreas im Zentrum variiert der Film das Thema Stille vielfältig: als Schweigen im Walde und Verstummen aus Angst und aus Sehnsucht, als Seelen- wie als Friedhofsruhe, als nächtliche Geräuschlosigkeit, stille Übereinkunft zwischen Liebenden, Totenstarre. Statt in urlaubslandschaftliche Sommerwärme führt der Film (in dem auffallend viel gefroren wird) mit seiner Kühle und Kälte, seiner unzerredeten Kargheit in eine Natur, die den Blick, das Herz, die Lungen schrankenlos zu weiten vermag, aber auf ihrer Unbeherrschbarkeit besteht: Sie lässt sich nicht einfrieden, und vor der Feindseligkeit ihrer Katastrophen gibt es keine Zuflucht. Die Steinmassive in ihrer nicht zu erweichenden Feierlich- und Fürstlichkeit vor sich und um sich, beweist der Einzelmensch, wie unerheblich, winzig und vergänglich er stets war und ist. Noch auf dem beständigsten Felsen hat er „keinen festen Boden unter den Füßen“.
Selten zeigt das Kino einen Menschen so offenkundig aus seiner Gegenwart gefallen wie gegen Ende den unbestimmbar betagten Andreas, der gemeinsam mit anderen Dörflern im Fernsehen dem ersten Menschen auf dem Mond zusieht. Aus- und andauernd blieb und bleibt er „ein ganzes Leben“ lang, wer er war und wie er ist: aufrecht eingesponnen in sich selbst, ganz auf sich gestellt. „Ich brauche niemanden, aber ich habe alles, was ich brauche“, resümiert er, unbeirrt in seiner immerwährenden Genügsamkeit. Über sein Woher und Wohin denkt er nicht nach, aber „die Zeit dazwischen“, schreibt er an die Marie seiner Erinnerungen, als alter Einsiedler schon wie in einem Felsengrab hausend, die hat ihn „staunen“ gemacht. Er geht, wie er gekommen ist: verwaist, allein, zufriedengestellt.
57. Internationale Hofer Filmtage
Allein in den Städten
Als Autorenfilmer reinsten Wassers setzt Carsten Jain-Pütz bewährte Festival-Traditionen fort. In „The Connections“ erzählt er von zwei Geschwistern, die nicht wissen, wohin mit ihrem Leben, und führt, trotz großer räumlicher Distanz zwischen den beiden, ihre Geschichten zu einer zusammen.
Von Michael Thumser
Hof, 30. Oktober – In den ersten Auflagen des Festivals waren alle Filme kurz; während seiner frühen Jahre wurden sie länger und blieben dennoch „Neue Deutsche“ Filme – „Autorenfilme“ reinsten Wassers also, deren Regisseure auch das Drehbuch verantworteten und unabhängig von den großen Studios produzierten. Daran hat sich viel geändert, gleichwohl gibt es noch Autorenfilmer in Hof, und Carsten Jain-Pütz darf von sich behaupten, ein multipel talentiertes Musterexemplar zu sein: Das Geschwisterdrama „The Connections“, seine Abschlussarbeit an der Fachhochschule Dortmund, inszenierte er nicht nur, er schrieb auch das Skript, besorgte den Schnitt, firmierte als Produzent und schuf sogar die Musik. Im Abspann nimmt die Liste der credits schier kein Ende – trotzdem scheint es, als hätte Jain-Pütz alles ‚ganz allein‘ gemacht. Ein Mann, der weiß, was er will; kein Wunder, mit Anfang vierzig.
Indessen wissen seine Hauptfiguren, ungefähr zehn Jahre jünger, gar nichts mit sich anzufangen. An Begabung herrscht bei der einen so wenig Mangel wie beim anderen. Aber Hanna (Vanessa Thüring), durch Lissabon trudelnd, bringts einfach nicht fertig, sich mit ihren Zeichnungen an der Kunsthochschule zu bewerben; und ihr Bruder Jonas (Alexander Peiler), spürsinniger Fotograf in Berlin, puzzelt am Computer lieber an Bildern herum, die er nie verkaufen wird, statt sich den Diktaten einer kommerzorientierten Werbeagentur zu unterwerfen; wiederholt sieht man ihn laufen, doch er kommt nicht an. So trudeln die beiden von Gott, Welt und allen guten Geistern verlassen durch die Metropolen und erfahren peinigend, dass „Städte Orte der Isolation sind“, voll von „einsamen Menschen“ wie sie selber.
Was „aus ihren Träumen geworden“ sei, werden sie gefragt, während Plakatwände, Bildschirme und hippe Hochglanzmagazine, erst recht die einlullende Stimme eines Affirmationscoachs aus dem Off, sie mit Mantras aus dem faulen Erfolgs-Evangelium moderner Glücksverheißung malträtieren: Genieße das Leben; du bist attraktiv und sexy; du hast ein Recht auf Deine Freiheit … Gute Geister, um bei der Wahrheit zu bleiben, gibt es schon: Luis, einen aufopfernd verliebten Freund Hannas, Jonas’ lange langmütige Partnerin. Doch auch sie kennen kein Mittel gegen Lethargie und Lähmung. Die Geschwister stoßen sie vor die Köpfe und stoßen sie von sich und wiederholen – gefragt, wies um sie stehe – stets dieselbe lasche Lüge: „Alles gut soweit. Es läuft.“
In zwei Alltagsgeschichten erzählt Carsten Jain-Pütz vom Stillstand zweier nicht mehr ganz junger, hilfloser Leben an der letzten Schwelle zu einem „verantwortlichen“ Erwachsensein. Zwei scheinbar wenig erhebliche Geschichten; streng parallel verlaufen sie, berührungslos, in weiter Distanz voneinander. Der Regisseur aber hält seine Protagonisten nicht bloß auf Abstand; ebenso stiftet er durch Leitmotive, Grundmuster und eine formbewusste Dramaturgie der Gleichzeitigkeit unauflösliche connections zwischen ihnen: weitreichende Anschlüsse und Verbindungen, untergründigen Zusammenhang und -halt. Nicht anders reiht er die Einzelszenen auf: Vielsagend isoliert stehen viele – die meisten – für sich; dennoch überführt sinnstiftende Montage sie in ein Doppel-Standbild und bewegt sie insgeheim auf ein finales Hoffnungszeichen zu.
Das freilich nichts beschönigt. Die Karrieristin Clara (Bettina Lieder), „attraktiv“ und „sexy“, noch keine vierzig, bombensicher in dem, was sie will, vermeintlich „frei“, sie hält anklagend ein Plädoyer gegen Jonas, den schluffigen „Verweigerer“: Man könne, belehrt sie ihn, „aus seinem Leben nur was machen, wenn man sich nicht querstellt“. Ihr Verdammungsurteil heißt: „Du bist jetzt ganz allein.“ Nach dem Schuldspruch aber steht die Schöne in ihrer schicken Wohnung selbst verloren und verlassen da. In ihrem Yuppie-Job ist sie Spitze: einsame Spitze.
■ Die Hofer Filmtage im Internet: hier lang.
57. Internationale Hofer Filmtage
Wie man die Welt aushält
Vor dreizehn Jahren fragte das Regie-Duo Starost-Grotjan sieben hellköpfige Kinder, darunter die Schwestern Vassileva aus Hof, nach dem Sinn des Lebens. Nun, da die Kleinen von einst erwachsen und noch klüger sind, stellen sie sich in der Doku „7 oder Wie halte ich die Zeit an“ dem Rätsel aufs Neue.
Von Michael Thumser
Hof, 29. Oktober – Warum sind wir auf der Welt? Eine Frage, an der sich die Erwachsenen, zumal gelernte und gelehrte Philosophen, seit ein paar Tausend Jahren die Zähne ausbeißen. Lösen können das Rätsel vielleicht nur Kinder – und wie unverstellt und fantasievoll, hellköpfig und tiefensichtig sies versuchen, zeichneten Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn vor dreizehn Jahren mit der Kamera auf: Ihre Dokumentation „7 oder Warum ich auf der Welt bin“ kam 2011 bei den Filmtagen erstmals auf die Leinwand, tourte dann durch viele weitere Festivals, gewann Preise und entzückt seither ungebrochen das Publikum der Programmkinos. Von sieben Mädchen und Jungs aus Hof, Deutschland und der Welt hatte das Berliner Regie-Paar Antworten auf die Frage aller Fragen eingeholt, kluge An- und Einsichten, denn „man hat immer was zum Nachdenken“, sagte seinerzeit eines der Kinder aus Erfahrung und ganz ohne Altklugheit. Verständlicherweise reizte es die Filmemacher, sich mit gehörigem Abstand neuerlich den Protagonistinnen und Protagonisten von einst zuzuwenden.
In Hof, wo die Idee zu dem Projekt 2006 wie zufällig entstanden war, feierte nun die Fortsetzung Weltpremiere. Die Vorführung am Freitag wollte sich auch Vivi Vassileva, die inzwischen weltweit aktive Musikerin, nicht entgehen lassen, ist sie doch hier geboren und aufgewachsen – und hat, wie ihre Schwester Vici, den fertigen Film „7 oder Wie man die Zeit anhält“ zuvor noch nicht gesehen. Bis heute, sagt sie nach der Vorführung, bewundere sie die Regisseurin und den Regisseur dafür, wie ernst sie die Kinder vom ersten Treffen an genommen hätten: „Sie begegneten uns auf Augenhöhe.“
Zwischen sieben und dreizehn waren die sieben damals und sind heute zwischen zwanzig und sechsundzwanzig Jahren alt. Die Jugendzeit haben sie alle hinter sich, wenn sich auch unterschiedliche Reifegrade des Erwachsenseins bemerkbar machen. Gegen die respektvoll diskreten Porträts der sieben schnitten Starost und Grotjahn ausgewählte, bisweilen nüchtern-poetische Einblicke in ihre sehr verschiedenartigen Lebensräume und -verhältnisse. Zu Beginn der Dreharbeiten vor etwa fünf Jahren erwartete Vivis Schwester Vici selbst ein Kind und kam sich, mit dem „Wunder“ in ihrem Bauch, „wie Superwoman“ vor; heute, da der Nachwuchs längst auf der Welt ist, fühlt sie sich in ihrer eigenen „Geschichte mehr im Mittelpunkt als vorher“.
Die anderen bringen ihr Studium zu Ende, wie Jonathan, das Mathematikgenie, oder gehen schon Berufen nach, so Vanessa, die in Ecuador mit ihrer Mutter einen Laden betreibt und Optikerin werden will. Für die Zukunft weiß Chrysanthi, die griechische Ergotherapeuthin, keine großen Ziele anzugeben, dies aber schon: „Unglücklich möchte ich nicht sein.“ Basile aus Paris hingegen verfolgt ohne falsche Illusionen den „Plan“, dereinst in einem eigenen Geschäft selbst gestalteten Schmuck zu verkaufen. Albrecht, zur Drehzeit FSJler in einem Krankenhaus, findet, nichts wäre schlimmer, als wenn schon jetzt „alles klar und sicher wäre“. Besonders weit hat es Vivi gebracht: Als phänomenale Perkussionistin zählt sie international zu den herausragenden Tonkünstlerinnen ihrer Generation. Leben ist Prozess: „Wie man die Zeit anhält“, weiß auch Basile nicht, obwohl ers gern täte.
Von der Weisheit der frühen Jahre weichen die vier jungen Frauen und drei jungen Männer heute nicht grundlegend ab; für das Gesagte von früher, das der neue Film immer wieder, durch Rückblenden in den alten, zitiert, schämen sie sich nicht; es gäbe keinen Grund dafür. „Der Mensch ist zugleich die Blüte, aber auch der Winter“, sagte 2010 eines der Kinder, „wenn die Menschen verschwinden, bleibt die Erde zurück und hat ihre Ruhe.“ Das gilt heute nicht anders und noch dringlicher, zur Schwarzseherei aber lässt sich davon keiner der jungen Menschen verleiten. „Warum bin ich auf der Welt?“: Abermals vor die alte und ewige Frage gestellt, antworten sie mit Vertrauen in die Zukunft und sich selbst. Sie sind da, um etwas von sich und überhaupt das Leben weiterzugeben; um Teil eines Ganzen zu sein; um die Welt besser zu machen; um selbst zu „glänzen“; oder um für andere „ein Sonnenschein“ zu sein … Oder schlicht: um das Dasein zu genießen.
Zwar, zeitgemäßes Problembewusstsein macht sich in allen Ahnungen und Annahmen, Erkenntnissen und Gedankengängen geltend, aus denen sich die Auskünfte fügen. Weit deutlicher jedoch, nicht selten leuchtend spricht aus ihnen erwartungsvoller Mut, hochansteckender Optimismus. Nicht wie man „die Zeit anhält“, aber wie man die Welt aushält, lässt sich hier lernen.
■ Die Hofer Filmtage im Internet; hier lang.
57. Internationale Hofer Filmtage
Kurz vorm Kippen
Ein Ü-60-Lustspiel: Ben von Grafenstein bringt das kauzige Vermächtnis Zoltan Pauls nach Hof. In „Überleben in Brandenburg“ trägt der 2022 gestorbene ungarisch-österreichische Regisseur und Schauspieler den (Wahl-)Kampf gegen die völkische Rechte sehr entspannt in der ostdeutschen Provinz aus.
Von Michael Thumser
Hof, 28. Oktober – Kann und darf man, heute in Deutschland, „nicht rechts, nicht links, nicht Mitte“ sein, weil man politisch „darübersteht“? Dem österreichischen Schauspieler und Filmemacher Zoltan Paul war es wichtig, freiheitlich Haltung zu zeigen, beobachtete doch der in Ungarn aufgewachsene Österreicher mit Grausen, wie sich in der Heimat seiner Kindheit ein autoritäres Regime breitmacht. Hierzulande als Demokrat überleben, zumal im Osten der Republik, sozusagen rechts von der einstigen innerdeutschen Grenze – wie soll das auf Dauer gehen, wenn bei Umfragen zum Beispiel in Brandenburg, elf Monate vor der dortigen Landtagswahl, die AfD sich mit 32 Prozent vor alle anderen Parteien setzt?
Im vergangenen Jahr starb Zoltan Paul, erst 68-jährig, in Berlin und hinterließ die Bruchstücke einer Komödie, die der Regisseur Ben von Grafenstein abrundend vervollständigte. Mit dem Ergebnis ist er nun erstmals bei den Hofer Filmtagen dabei, denen Paul zwischen 2012 und 2022 vier Mal die Ehre gab. Ein Vermächtnis also, ein lustiges und zugleich bedenkenswertes. In „Überleben in Brandenburg“ spielt Zoltan Paul sich selbst, wenn auch unter falschem Namen. Laszlo Kovacz heißt er hier und vertrödelt als nicht eben erfolggekrönter Regisseur in einem ostdeutschen Kaff wohlhabend und ungestört die Zeit, als zunächst ein provokanter Nachbar, dann eine unberechenbare Nachbarin seine herbstlichen Potenziale herausfordern. Während er dem blonden Gift der soziopathischen Sexgöttin verfällt, lässt er sich, wenn auch widerstrebend, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl gegen den Kandidaten einer völkischen Rechtspartei aufstellen – obwohl er doch eigentlich als herzkranker, wenngleich vitaler „Althippie-Träumer“, Tunichtgut und Kauz gern „darüberstehen“ würde: über Gesinnungsstreit und Familiengezänk, über der Liebe und überhaupt dem Dasein. Das aber drohen der Wahlkampf und andere Konflikte gehörig aus der Kurve zu tragen.
„Ich glaube“, sagt Regisseur Ben von Grafenstein in Hof, „den Film versteht hier jeder“. Wohl wahr. Auch wenn der Name AfD nie fällt, „versteht“ sich von selbst, um wen und was es sich bei Laszlos Gegenspieler handelt. Eine krachende Meinungsschlacht auf dem Lande hätte Zoltan Paul in seinem Drehbuch um ihn entfesseln können, oder im Kleinen vor dem Niedergang der Freiheit im Großen warnen, oder eine erotische Politposse durchdeklinieren. Lieber indes hielt er, sich die Hauptrolle auf den eigenen gut gehaltenen Leib schreibend, entspannt den Ball so flach wie seinen Bauch. Laszlo, ein milder, unversehens überforderter Lebenskünstler und -genießer, greift als Bürgermeisterkandidat nicht nach den großen Themen, sondern fragt bei den Leuten nach den Alltagskleinigkeiten nach, gratuliert ihnen zum sechzigsten Ehejubiläum, lässt sich von ihnen den verseuchten Dorfsee zeigen, der „kurz vorm Kippen“ steht.
Auch Nachlassverwalter Ben von Grafenstein umgeht alles Zeichenhafte, Überschwere. Vielleicht darum bediente sich der eine wie der andere der schlichten Filmästhetik vergangener „Fernsehspiel“-Epochen und der Mitwirkung von Laien aus der ländlichen Bevölkerung am Drehort, mit Dialogen und Auftritten, die oft wie eben ausprobiert, wie Improvisationen wirken. Keinen Schaden nimmt die Geschichte daran, dass sie hier und da stottert, stockt und stolpert und überhaupt großzügig darauf verzichtet, richtig in die Gänge zu kommen. Fernab der Ballungsräume und der Metropolen gehen die peripheren Uhren eben halb so schnell.
Oft und anhaltend füllt Laszlos Schelmenkopf mit seinem Schalksgesicht die Leinwand, als hätte Zoltan Paul am eigenen Beispiel demonstrieren wollen, wie leichtlebig und naturbelassen einer altern kann. Ein Ü-60-Lustspiel ist sein Film ohnehin, für den sich neben ihm Adele Neuhauser (als Laszlos sieggewohnte Gattin), Dietrich Hollinderbäumer (als Schluckspecht und Schwiegervater) und der – auf Schurken abonnierte – Joachim Assböck als Rechtsaußen vor Jan Kerharts Kamera versammeln. Hier tummeln sich also jahrzehntelang erprobte Koryphäen doppelbödiger Charakterkunst.
„Nicht rechts, nicht links, nicht in der Mitte“? In altersweiser Beiläufigkeit bekennt Laszlo, lieber als die Geschichten aus der Wirklichkeit seien ihm die erfundenen: „Da weiß man, wie sie ausgehen“. 2024 wird nicht nur in Brandenburg, auch in Thüringen und Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt, und wie die Geschichte ausgeht, lässt sich schon ahnen. Gegen Gift ist die Demokratie so allergisch wie der See in Laszlos Kaff: Irgendwann kann auch sie kippen.
■ Die Hofer Filmtage im Internet: hier lang.
57. Internationale Hofer Filmtage
Plötzlich ist alles anders
„Wald“ heißt das Festival-Debüt von Elisabeth Scharang: Schwer traumatisiert rettet sich eine Journalistin in die spätzeitliche Natur eines österreichischen Hinterlands. Bildpoetisch setzt der Film auf Schweigen und Stille und bricht doch die Stummheit zwischen zwei einander entfremdeten Freundinnen auf.
Von Michael Thumser
Hof, 27. Oktober – Man kann, zum Beispiel durch einen Unfall, ein Bein verlieren und dennoch seelisch heil aus der Not herauskommen. Marian hingegen, in Elisabeth Scharangs Film, erlebt das Verhängnis umgekehrt: Als ein Terrorist bei einem Straßencafé in die Menge schoss, blieb sie äußerlich unverletzt – im Innern indes hat sie schier nicht wiedergutzumachend Schaden genommen.
Schlicht „Wald“ überschrieb die österreichische Regisseurin ihr Filmtage-Debüt (so wie Doris Knecht 2015 ihren Roman, von dem sich Scharang wichtige Motive entlieh). Denn die Stille mitten in dem Meer aus Bäumen fern der Stadt, die öden Weiten des flachen Landes darum herum sind das Einzige, was Marians traumatisiertes Gemüt noch erträgt. Lange ist sie als urbane Journalistin durch die Welt und deren Krisengebiete gereist – nun aber, in der Krise, die ganz sie selbst betrifft, zieht es sie auf schmalen Straßen dorthin zurück, von wo sie mit sechzehn Jahren aufbrach und floh: in den längst vergammelten Bauernhof ihrer Kinderjahre. Ohne Auto und Strom, Fernsehen und Radio stellt sie sich ganz auf sich; sogar das Handy sperrt sie, sich verweigernd, weg. Nach den Schüssen und der Angst ist für Marian „plötzlich alles anders“. Innerlich wie ausgeleert, erfüllt von einer Art Grabesruhe, fühlt sie sich zu Tode erschrocken, mehr noch: um ihr gewohntes Leben gebracht, vielleicht für immer. „An die Zukunft zu denken, überfordert mich, die Vergangenheit macht mich traurig“, sagt sie dem geliebten Mann, der sie kurz besucht und den sie wieder fortschickt. „Der einzige Ort, jetzt, ist hier.“
Nachbarschaft ohne Nähe
In langen Einstellungen und Sequenzen forschen die Regisseurin und Jörg Widmer mit der Kamera die scharfen Züge, den hilflosen Aktionismus, die mutlosen Erstarrungen ihrer ausdrucksfeinen, ausdrucksstarken Hauptdarstellerin Brigitte Hobmeier aus und setzen sie mit Haus und Hof, Wald und See, Erde und Himmel in ein atmosphärisch ungemein stimmiges Verhältnis. Dann tritt, mit nicht minder plastischem Gesicht, Gerti Drassl hinzu, als Marians Hofnachbarin Gerti eine nicht minder markante zweite Protagonistin. Allerdings – für eine Nachbarschaft ohne Nähe steht sie: Denn Marians Einkehr in die Einsamkeit ist zugleich eine Heimkehr in zerstörte Vertrautheiten, ungeklärte Vorbehalte, schwelende Animositäten. Zu den Dörflern, die Marian nicht bei sich haben wollen – und sie buchstäblich vor den Kopf stoßen –, zählt Gerti auch. In Jugendtagen gehörten die beiden verschworen zusammen, bis Marian, verschwindend, sie schutzlos bei ihrem bitterbösen Vater und der unbeholfenen Mutter zurückließ. Seither hat die Zeit Gerti hart und trocken gemacht. Nun wirft sie der Zurückgekehrten vor, sie verraten zu haben. Und taut dann doch allmählich auf.
Auch in der Natur tauts am Ende. Zwischen Herbst und Winter und Vorfrühling hat die Regisseurin den gemächlichen, gleichwohl insgeheim erregten Gang der Handlung angesiedelt und trotzdem die Zeit scheinbar zum Stillstand gebracht. Aus Momenten, kaum aus Geschehnissen fügen sich die redescheuen Episoden, aus Blicken auf alte Fotos, aus eingeatmeten Gerüchen, vorsichtigen Berührungen mit Resten des Gestern. Dabei erfährt Marian, dass Alleinsein und Einsamkeit ein und dasselbe sein können inmitten einer Natur, die sich in den Bildern nicht aufgehübscht, sondern in einer dem Wortsinn nach natürlichen, weil abweisend aufrichtigen, spätzeitlich vernebelten Schönheit offenbart. Weil, so wie Wald und Flur, auch Schweigen und Stille diskrete Triebkräfte des Films sind, fallen alle Geräusche, Stimmen, Schreie, dazu die sinngleiche (Klavier-)Musik von Hania Rani umso expressiver ins Gewicht. Erst recht die Gewalt: Wie in den Krisengebieten der Welt geschieht sie in Österreichs hinterstem Winkel, tödlich auch hier.
Für ein kleines Wunder darf gelten, dass der so sparsamen wie sorgfältigen Erzählung alle niederdrückende Schwere abgeht. Darauf hat Elisabeth Scharang in den mutlosen Augen- wie bei aufmunternden Lichtblicken zu achten gewusst, erzählt sie doch nicht weniger als drei Geschichten auf einmal: nicht die einer tiefen Verletzung allein, auch die einer Freundschaft und die einer Befreiung.
■ Die Hofer Filmtage im Internet: hier lang.
57. Internationale Hofer Filmtage
Erst wer stirbt, verschwindet
Im Eröffnungsfilm des Festivals dockt Chris Kraus als begnadeter Kino-Erzähler an seinen Sensationserfolg „Vier Minuten“ aus dem Jahr 2006 an. Bis in dessen Seelentiefen dringt „15 Jahre“ zwar nicht vor. Aber die Besetzung imponiert, allen voran die neuerlich hinreißende Hannah Herzsprung.
Von Michael Thumser
Hof, 26. Oktober – Kann man ‚einfach so‘ weitererzählen, nach sechzehn Jahren? Darf Chris Kraus erwarten, dass treue Filmtagebesucher und Kinogänger die Geschichte seines frühen Meisterwerks „Vier Minuten“ von 2006 präsent genug im Kopf haben, um dem Schicksal der Protagonistin Jenny von Loeben jetzt problemlos weiter folgen zu können? Klug genug ist der Regisseur und Autor, einer der besonders einfallsreichen und geschickten Erzähler des aktuellen deutschsprachigen Kinos, um mit „Fünfzehn Jahre“ nicht einfach ein Sequel draufzusetzen. Vielmehr besinnt er sich ambitioniert auf die alte Geschichte, um aus ihren Wurzeln eine fast neue wachsen zu lassen, eine, die durchaus für sich steht und besteht – eine andere Geschichte.
144 Minuten lang spürt Kraus der Frage nach: Wofür soll, kann, wird Jenny, die Frau, „die im Herzen explodiert“, sich entscheiden – für Vergebung? Für Vergeltung? Gerade zwanzig war sie und als Pianistin einzigartig talentiert, als sie für einen Mord, den ihr Freund beging, die Schuld auf sich nahm und im Knast verschwand, für fünfzehn lange Jahre. „Das zieht sich.“ Nun, endlich frei, sucht sie ihr Heil – ja, worin? Im Himmel? In der Rache? Jedenfalls in einer Form ausgleichender Gerechtigkeit. Aber sogar als Beterin im „Team Jesus“ ist und bleibt sie „immer noch die alte Jenny“, eine „Soziopathin“, verbockt, verschlossen und eruptiv bereit zu grausiger Gewalt. Von neuen „Begegnungen“ dürfe sie neue Lebensrichtungen erwarten, verheißt „Team“-Leiterin Markowski (scheinbar abgeklärt, doch selbst nicht ohne dunkle Seite: die herrlich borstige Adele Neuhauser). Sehr widerstrebend „begegnet“ Jenny dem einarmigen syrischen Musiker Omar, den der IS verstümmelt hat. Bei ihm ahnt sie eine zögerliche Art von Liebe, mit ihm nimmt sie an einer Talentshow für Menschen „mit Behinderung“ teil: Ein rührend singendes „Kriegsopfer“ und eine Tastenakrobatin mit „Borderline“ - solch ein Duo passt goldrichtig ins Konzept krawallbunt aufgeblähter Abgeschmacktheiten. Im Studio indes trifft Jenny auf ihre Vergangenheit, die „einfach nicht vorbei“ sein will: In Gimmiemore, dem gefeierten Popsänger und überheblichen Juror, erkennt sie den Verräter von einst; kein Zufall, da ist sie sicher, sondern „ein Gotteszeichen“, um ihm den „Krieg“ zu erklären.
144 Minuten - aber es „zieht sich“ nicht. Chris Kraus, der so gut Geschichten erfinden kann, kann sie auch auf eine Weise erzählen, wie allein der Film es vermag. Ein Meister ist er darin, mit einem vermeintlich kleinen Plot das sogenannte große Kino bis in alle Winkel auszufüllen. Gelegentlich bricht er, klärend statt verwirrend, die Chronologie der Episoden auf. Gegen den tristen Realismus von Jennys rauer Rückkehr in die bürgerliche Existenz schneidet er grob gekörnte Wackelvideos aus ihrer Punker-Jugend mit Gimmiemore und konfrontiert ihn grell mit dem unwirklichen Hochglanz und Superstargedöns, den Lasershows und zwischenmenschlichen Unaufrichtigkeiten im Mikrokosmos des Breitenfernsehens, das aus nichts besteht als aus der Oberfläche seiner Bilder.
Bis tief hinab unter die Oberfläche der Bilder führt Chris Kraus die wichtigsten seiner Charaktere, allen voran die neuerlich sensationelle Hannah Herzsprung. Der Fotografenschar im Foyer des Hofer Scala-Kinos präsentiert sie sich verhalten lächelnd mit der Glätte einer fast ätherischen Beauté – bevor die Leinwand sie schonungslos mit ungesunder Haut und den abgelebt unebenen Zügen vollständiger Desillusionierung porträtiert. Als Jennys Lebens- und Herzsprungs Filmpartner erweist sich nicht so sehr Omar, das invalide Terroropfer (Hassan Akkouch), den der Regisseur nervtötend wie ein hypermotorisches Kind inszeniert; weitaus facettenreicher, dadurch gleichrangig neben ihr agiert das Hassobjekt, der hippe Gimmiemore: Albrecht Schuch, zwischen schmalziger Telegenität und ehrlichem Endzeitbewusstsein famos changierend, nicht an dunkler Vergangenheit, sondern am sinnleeren Dasein leidend, erst recht an Krebs im letzten Stadium. An seinem Beispiel begreift Jenny, was sie mit Omar während der TV-Show in die Mikrofone schmettert: „Erst wer stirbt, verschwindet.“
Gimmiemores Welt ist die des Kitsches („Voll schön … ich habe geweint …“), und ein wenig tränenfeucht ist auch der Film geraten, der seinerseits nicht immer weit genug Abstand vom Kitsch hält. Manche Nebenfigur opfert das Drehbuch vordergründigem Humor, obendrein trägt die Symbolik – Jenny, einen erschossenen Löwen streichelnd und betrauernd – arg dick auf. An die dramaturgische und historische Vielschichtigkeit des Vorgängers, mit der aufwühlend spröden Monica Bleibtreu als Jennys posttraumatisch verheerter Klavierlehrerin, reicht das Sequel, das keines ist, nicht heran. 2006 riss die Uraufführung von „Vier Minuten“ das Hofer Publikum zum weitaus anhaltendsten Beifall hin, den der Schreiber dieser Zeilen je nach einem Festivalfilm erlebt hat. Auch heuer, am Eröffnungs-Dienstag, applaudierten die Zuschauenden heftig, zwar bei weitem nicht so lang, doch für Hannah Herzsprung ehrerbietig stehend. Wohlverdient.
So weit bewährt sich das notorische Erzähltalent des Regisseurs dann doch, dass er ihr und seiner dünnhäutig verletzlichen, hinreißend heftigen – von ihm zweifellos geliebten – Hauptfigur ein Happy End verweigert. In der poetisch anrührenden (und wiederum ein wenig kitschigen) Schlussszene ist Herzsprung „immer noch die alte Jenny“ und trotzdem eine andere. Ergreifend singt sie am Klavier, allein jetzt; in der Luft lässt Kraus sie hängen, traurig, aber nicht verzweifelt und keineswegs „verschwunden“. Jenny von Loeben lebt: Was soll, kann, wird aus ihr wohl werden? Hoffentlich bringt Kraus es über sich, sie los- und ziehen zu lassen, fortan in Frieden.
■ Die Hofer Filmtage im Internet: hier lang.